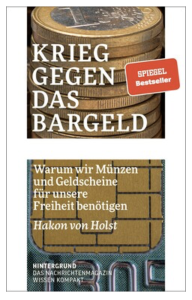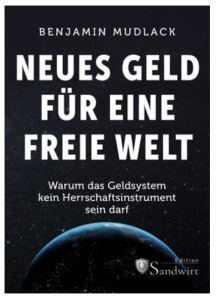Ein Gastbeitrag von Hakon von Holst
Deutschlands oberster Bargeldhüter bezahlt am liebsten mit dem Mobiltelefon: Burkhard Balz ist Bundesbank-Vorstand und leitet das Ressort Bargeld seit 2023. Der wahre Wert von Banknoten und Münzen zeigt sich seiner Meinung nach in Krisenfällen, also bei Stromausfällen wie in Spanien am 28. April 2025 oder bei Hackerangriffen.
Es ist ein Paradox: Würden alle Menschen ticken wie Balz, gäbe es zwar weiterhin gedruckte Scheine von der Bundesbank, aber von einem Zahlungsmittel, von barem Geld, könnte keine Rede mehr sein – auch dann nicht, wenn plötzlich die Geldkarten streiken. Die Notenbanker wissen das. Stefan Hardt, Leiter des Zentralbereichs Bargeld bei der Bundesbank, sagte im Juni 2024 in einer SWR-Fernsehsendung: „Wenn Sie der letzte Barzahler wären, dann würde sich sicherlich die Frage stellen: Wer betreibt noch einen Geldausgabeautomaten für Sie und welcher Händler nimmt noch Bargeld an?“
Alle positiven Eigenschaften des Bargelds stehen und fallen mit seiner Verwendbarkeit als Zahlungsmittel. Wer würde schon Geldscheine unter das Kopfkissen legen, wenn er sie erst auf der letzten Bankfiliale in der 50 Kilometer entfernten Kreisstadt einzahlen müsste, um nach dreiwöchiger Geldwäscheprüfung endlich über sein Geld verfügen zu können?
Statistisch greift die unterste Einkommensschicht am häufigsten zu Bargeld, Reiche bezahlen mit dem Mobiltelefon. Dafür besteht ein Anlass: Wer digital bezahlt, gibt je nach Studie ein Drittel mehr Geld aus, erinnert sich deutlich schlechter an den Kaufbetrag und unterschätzt die Anzahl seiner Einkäufe. Es wirkt disziplinierend, wenn man sich an der Ladenkasse von etwas trennen muss, und das tut man nur bei einem analogen, körperhaften Zahlungsmittel.
Was der Bundesbankvorstand verschweigt
Es gibt gute Gründe für das Bargeld und immer mehr Bürger, die sich Sorgen darum machen. Vor ihnen legt die Bundesbank ein Glaubensbekenntnis ab: „Bargeld wird nicht verschwinden“, betonte Balz am 6. Juli im Interview mit t-online. Angestoßen von der Deutschen Presse-Agentur verbreitete sich seine Botschaft ungefiltert durch die Tageszeitungen.
Außer beschwichtigenden Worten gibt es jedoch nichts, was einen beruhigen dürfte – im Gegenteil. Der Bundesbankvorstand verkennt die Probleme und sagt stattdessen: „Wir haben eine funktionierende Bargeldwelt.“ Wirklich? Zwischen 2019 und 2023 verschwand in der Bundesrepublik jede dritte Bankfiliale. Ladenbetreiber haben es immer schwerer, ihre Bargeld-Einnahmen auf einem Konto einzuzahlen. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Genth, erklärte im Oktober 2024, Bargeld sei ein wichtiges und beliebtes Zahlungsmittel, und warnte: „Wenn allerdings weiterhin immer mehr Bankfilialen schließen, droht der Bargeldkreislauf zusammenzubrechen.“
Die Probleme schlagen sich auch in den Statistiken der Bundesbank nieder. Gemäß einer repräsentativen Untersuchung der Notenbanker sahen sich die Deutschen im Jahr 2023 in Behördenangelegenheiten in 50 Prozent der Fälle gezwungen, digital zu bezahlen. 2021 waren es noch 37 Prozent. Dass der Staat auf Ämtern sein eigenes Zahlungsmittel ablehnt, ist für Hardt ein Unding. Sein Vorgesetzter Balz kann offenbar gut damit leben.
In anderen Sektoren hat die Stunde ebenfalls geschlagen: Erste Bäckereien bestehen auf Kartenzahlung; die Hamburger Sparkasse wirbt auf ihrer Internetseite für bargeldlose Cafés, Restaurants und Hotels in der Stadt – im eigenen Interesse. Eines ist klar: Zwischen den Mühlrädern der Wirtschaft wird aus Balz’ Bekenntnis Staub im Wind der Zeit.
Selbst wenn es um die ureigene Aufgabe der Bundesbank geht, unterschlägt der Bundesbankvorstand im Interview zwei Details. Es geht um die Frage: Wie kommt das bare Geld von der Notenbank zu den Privatbanken, damit der Bürger es nutzen kann? Balz rückte seine Organisation in ein gutes Licht: „In Deutschland optimieren wir stetig die Bargeld-Infrastruktur – 31 Filialen der Bundesbank versorgen das Land mit Bargeld.“ Kein Wort darüber, dass deren Anzahl im Jahr 2000 noch bei stolzen 35 lag. Und kein Hinweis darauf, dass die Bundesbank bis 2039 an weiteren acht Standorten schließt.
Der Staat vernachlässigt sein eigenes Zahlungsmittel
Hinter den privaten digitalen Zahlungsmitteln der Banken und Zahlungsdienstleister steht ein Milliarden-Werbebudget. Bargeld ist im Wettbewerb auf sich allein gestellt – es sei denn, der Staat gewährt seinem eigenen Zahlungsmittel Schutz. Weder die aktuelle noch die vergangene Bundesregierung hat sich damit einen Namen gemacht.
Von der Bundesbank ergeht kein Appell an die Politik, endlich zu handeln. Hardt sagte erst im November 2024, es bestehe derzeit kein Zugangsproblem zu Bargeld – und das, obwohl laut Bundesbank-Daten inzwischen 15 Prozent der Bürger beklagen, es sei „ziemlich schwierig oder sehr schwierig“, „zu einem Geldautomaten oder Bankschalter zu gelangen“. Gegen neue Vorschriften für die Banken brachte Hardt die Vertragsfreiheit in Stellung. Demnach also soll sich der Bürger schlicht die passende Bank suchen, eine anständige Bargeld-Versorgung aushandeln – und schon steht ein kostenloser Geldautomat in Wohnortnähe. Die Realität sieht ein wenig anders aus.
Gegen eine zwingende Annahmepflicht für Bargeld an der Ladenkasse argumentiert die Bundesbank nach demselben Muster. In einer MDR-Sendung vom 5. November 2024 wurde Balz mit der Frage konfrontiert, mit welchem Recht Händler das einzige gesetzliche Zahlungsmittel Bargeld ablehnen. Seine Antwort: „Sie haben eben das hohe Rechtsinstitut der Vertragsfreiheit, dort können eben Zahlungsmodalitäten festgelegt werden. Die Käuferseite kann ja auch im Grunde genommen dann einen Vertrag ablehnen, etwas nicht kaufen.“
Die neue Koalition plant einen Annahmezwang für digitale Zahlungsmittel. Wo bleibt die Entrüstung der Wächter über die Vertragsfreiheit? Im Interview mit t-online reagierte Balz wohlwollend auf die Pläne: „Wenn die Politik sagt, Händler sollen neben Bargeld auch die Girocard akzeptieren, habe ich dafür Sympathie – denn es erweitert die Wahlmöglichkeiten der Kundinnen und Kunden.“ Im Nachsatz gab der Bundesbankchef zu bedenken, es sei eine andere Frage, „wie detailliert der Staat vorschreiben sollte, welche Zahlungsmittel ein Geschäft akzeptieren muss“.
Für den Handel wäre der Digital-Zwang jedenfalls ein doppelter Eingriff in die Vertragsfreiheit. Der Ladenbetreiber müsste nicht nur dem Kunden erlauben, elektronisch zu bezahlen, sondern auch die Angebote der Banken und Zahlungsdienstleister schlucken, da er nicht mehr ablehnen kann. Ein Bargeld-Annahmezwang auf der anderen Seite würde das Recht der Bürger auf Privatsphäre schützen und die Freiheit, einen Kartenvertrag mit der Bank ungenutzt zu lassen. All jene, die nicht digital bezahlen können, hätten die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.
Die Kämpfer in der Bundesbank sind Vergangenheit
Das Verbot für Barzahlungen ab 10.000 Euro in der EU ab 2027 nennt Balz (CDU) einen guten Kompromiss zwischen Freiheit und Kontrolle. Damit bewegt er sich auf Parteilinie. Sein Vorgänger im Bargeld-Ressort der Bundesbank, Johannes Beermann (ebenfalls CDU), fiel noch mit anderen Tönen auf. Er sagte 2021: „Bislang gibt es keinen wissenschaftlich fundierten Beleg, dass mit Barzahlungsobergrenzen das Ziel erreicht wird, Geldwäsche zu bekämpfen.“
Beermanns Vorgänger Carl-Ludwig Thiele (FDP) äußerte sich 2016 noch deutlicher: „Freiheit stirbt scheibchenweise.“ Unter seiner Leitung veranstaltete die Bundesbank 2017 einen internationalen Kongress zum „War on Cash“ – dem „Krieg gegen das Bargeld“, den einst große Zahlungsunternehmen ausgerufen hatten. Kritische Stimmen kamen zu Wort und durften interessengelenkte Anti-Bargeld-Argumente zerpflücken. Offenbar haben die Marketing-Kampagnen der Finanzwirtschaft die Gesellschaft inzwischen so weit durchdrungen, dass sich die Bundesbank angepasst hat und still bleibt. Noch im März 2020 konterte Johannes Beermann einen Werbe-Schachzug der deutschen Banken: Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes trat mit ihm gemeinsam in einer Pressekonferenz auf und zerpflückte den Mythos vom ansteckenden Bargeld.
Österreich als Vorbild
Im Interview behauptet Balz, die Bundesbank könne lediglich Anstöße für Verbesserungen geben – umsetzen müssten sie Wirtschaft und Politik. Das Beispiel Österreich zeigt jedoch, dass die Bundesbank Möglichkeiten hätte, ihr eigenes Zahlungsmittel zu verteidigen – und nicht nur zu reden. So setzte sich die Münze Österreichs, ein Tochterunternehmen der Nationalbank, bereits mit einer Werbekampagne für das Bargeld ein. Die Geldservice Austria, eine weitere Tochtergesellschaft, betreibt sogar einen Bargeld-Fanshop.
Der scheidende Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann forderte schon 2023 eine zwingende Annahmepflicht für Bargeld. Er warnte vor einer Entwicklung wie in den Niederlanden. Dort lehnen mittlerweile 21 Prozent der Apotheken und 38 Prozent der Kinos Bargeld ab. In Österreich ist der Anteil der Gemeinden ohne Geldautomat weit geringer als in Deutschland. Trotzdem möchte die Nationalbank eine Trendwende und handelt: Bis zu 120 Automaten stellt die Notenbank in Eigeninitiative in unterversorgten Gebieten auf. Das erste Gerät steht seit dem 1. Juli in einer Kommune in Niederösterreich.
In Österreich besitzt das Bargeld einen echten Anwalt. Wenn die Politiker im Bundesbank-Vorstand das Bargeld schützen wollen, sollten sie sich dort ein Vorbild nehmen. Unterstützung in der mittleren Etage wäre ihnen gewiss. Ein leitender Bundesbank-Mitarbeiter sagte zu mir, so ein offensiver Ansatz wie in Österreich würde ihm persönlich besser gefallen.
Dis ist ein Open-Source-Beitrag des Berliner Verlags. Er erschien zuerst auf berliner-zeitung.de
„Nie wieder“ war gestern: Der Fall Leandros zeigt, wie moralische Säuberung wieder schick ist
Wurde der Ton beim Weidel-Interview manipuliert? ARD unter Verdacht – Tontechniker entlarvt?
Merz taumelt ins Kanzleramt – aber um welchen Preis? Das wahre Drama hinter dem zweiten Wahlgang
Hakon von Holst, Jahrgang 1999, recherchiert seit 2019 zur schleichenden Verdrängung des Bargelds. Sein aktuell erschienenes Buch „Krieg gegen das Bargeld“ ist ein Spiegel-Bestseller.
Bild: Shutterstock
Bitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.
Mehr zum Thema auf reitschuster.de

Digitaler Euro „technisch bereit“: Abschaffung des Bargelds rückt näher
Offiziell als Mittel zur Bekämpfung von Terror und Geldwäsche verkauft, kann das Projekt schon bald zur Überwachung der eigenen Bürger eingesetzt werden. Im ersten EU-Land sollen Euro-Münzen und -Noten schon in fünf Jahren ganz verschwinden. Von Kai Rebmann.

„Legal oder strafbar? Darf ich zu Hause unbegrenzt Bargeld horten?“
Ist der Reitschuster jetzt durchgedreht, werden Sie sich bei dieser Überschrift fragen. Nein. Sie stammt aus dem Focus. Und hat mich maßlos geärgert. Hier die Geschichte dazu…

„Bitcoin-Strategie“ als Rendite-Beschleuniger?
Steigende Baukosten, Zinsdiktat der EZB und ein instabiles Geldsystem zwingen zum Umdenken: Warum die Immobilienblase nicht nur eine Preisfrage ist – und Bitcoin mehr als Spekulation sein kann. Eine Analyse von Benjamin Mudlack.