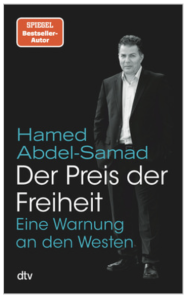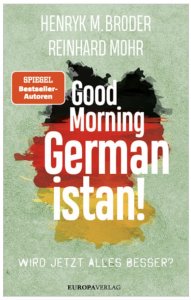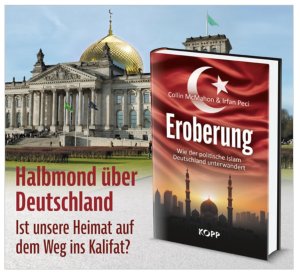„Ich will nicht mehr für jeden verfügbar sein.“
„Ich will Respekt, nicht Blicke.“
„Seit ich das Kopftuch trage, sehen mich die Jungs anders.“
Das sind keine Sprüche aus Afghanistan, nicht aus einem Mädchenheim im Iran – sondern ähnliches ist in deutschen Klassenzimmern zu hören, in Schulhöfen, in Podcasts. Mädchen, geboren in Berlin, Köln, München – mit deutschen Namen, deutscher Muttersprache – bekennen sich zum Islam. Mit Sprüchen wie diesen.
Sie ziehen sich – anders als ihre Altersgenossinnen in vielen islamischen Ländern, das Kopftuch nicht über, weil sie unter Druck stehen. Sondern weil sie es wollen. Weil sie glauben, dort etwas zu finden, was ihnen die eigene Kultur nicht mehr geben kann: Ordnung. Klarheit. Halt.
Die Journalistin Julia Ruhs – eine überaus positive Ausnahmeerscheinung in der deutschen Medienlandschaft – hat in einem Artikel für „Focus online“ genau hingehört. Und sie beschreibt darin eine Entwicklung, die noch weit unterschätzt wird: Junge Frauen, die sich freiwillig verhüllen – und sich dabei als feministisch, selbstbestimmt und emanzipiert inszenieren.
Sie sprechen von Befreiung. Davon, sich nicht mehr dem Druck der äußeren Erscheinung beugen zu müssen. Sie filmen sich beim Binden des Kopftuchs, posten Vorher-Nachher-Bilder, bedanken sich für das „Geschenk des Islam“ und erzählen in Reels und Kommentaren von einem neuen Lebensgefühl. Alles freiwillig – und alles öffentlich.
Ruhs schildert diese neue, digital inszenierte Religiosität nicht als Randphänomen, sondern als wachsenden Trend. TikTok, Instagram und YouTube sind voll von Konvertitinnen, die ihre Verwandlung dokumentieren. Viele tragen westliche Namen, sprechen akzentfreies Deutsch, wachsen in nicht-muslimischen Familien auf – und erleben ihre Hinwendung zum Islam als Schritt in eine neue Klarheit.
Statt Abgrenzung scheint es ihnen um Zugehörigkeit zu gehen – aber nicht zur westlichen Mehrheitsgesellschaft, sondern zu einer religiös aufgeladenen Community mit festen Rollen, Regeln und Ritualen. Besonders das Kopftuch wird dabei als sichtbares Zeichen der Neuverortung inszeniert. Die religiöse Praxis verschmilzt mit digitaler Selbstdarstellung.
Wie das aussieht, schildert Julia Ruhs mit einer Reihe von Beispielen, die fast zu grotesk wirken, um wahr zu sein – und genau deshalb so viel über den Zeitgeist verraten: Da ist Sophie, blond und blauäugig, frisch konvertiert, die auf TikTok erklärt, was „Tawakkul“ bedeutet – das islamische Urvertrauen. Franziska zeigt ihren Weg vom Bikini zum Burkini – inklusive Video mit mehr als elf Millionen Aufrufen, in dem sie alte Strandbilder digital zensiert: jedes bisschen Haut übermalt, das heute nicht mehr gezeigt werden darf. Heute badet sie nur noch vollverhüllt.
Eine andere Konvertitin demonstriert, wie sie es schafft, ganz früh aufzustehen, um fünfmal am Tag zu beten. Sara liefert Tips, wie man den Hijab richtig stylt. Und Kiara, noch keine 20, erklärt, dass sie sich nur noch einen muslimischen Ehemann vorstellen kann – weil der Koran so viel Wert auf die Frau und deren gute Behandlung lege und ein islamischer Ehemann sie gut behandeln werde als Frau. All das stehe im Koran, sagt sie. Und sie meint das vollkommen ernst.
In den Posts sind Hashtags zu finden wie #convertie, #revertmuslim, #muslimtiktok oder #muslimgirl. Und sie vermitteln ein neues Selbstbild: Die junge Muslima als bewusste Entscheidungsträgerin – aufgeladen mit spiritueller Tiefe, weiblicher Würde und moralischem Anspruch.
Die westliche Gesellschaft, die diese Transformation ermöglicht, bleibt dabei oft nur als Kontrastfolie zurück: als Ort der Verwirrung, der Beliebigkeit, der Übergriffigkeit. Auch das ist Teil der Botschaft – unausgesprochen, aber klar: Ich habe mich bewusst abgewendet. Und bin jetzt angekommen.
Und während sich die Teile der jungen Generation lautstark neu definieren, herrscht auf Seiten der öffentlichen Debatte betretenes Schweigen. Medien, die sonst jede Form der Selbstinszenierung zum Thema machen, vermeiden auffällig jede Auseinandersetzung mit dem Phänomen. Da, wo nicht geschwiegen wird, wird in der Regel verharmlost – oder der Trend gar zur bunten Bereicherung verklärt. Die Frage, was hinter dieser Selbstverwandlung wirklich steckt, wird kaum gestellt. Und noch seltener beantwortet.
Ruhs stellt diese Entwicklung nicht polemisch dar. Sie beschreibt. Präzise, unaufgeregt, aber mit spürbarem Unbehagen. Und sie lenkt den Blick auf die Ironie dahinter: Ausgerechnet das Kopftuch, in weiten Teilen der Welt Symbol für Einschränkung, Druck und patriarchale Kontrolle, wird in deutschen Klassenzimmern und Universitäten zum Banner weiblicher Selbstermächtigung erklärt.
Was dabei verloren geht, ist das Bewusstsein für die reale Unterdrückung, die mit dieser Symbolik vielerorts verbunden ist. Für Millionen Frauen weltweit ist das Kopftuch kein Lifestyle, sondern Pflicht. Wer es nicht trägt, riskiert soziale Ächtung, Gewalt, Haft – oder Schlimmeres.
Diese Realität verschwindet hinter dem neuen Narrativ der Konvertitinnen. Ihr Stolz überdeckt die Angst der anderen. Ihre Videos übertönen das Schweigen jener Mädchen, die auch in Deutschland das Tuch nicht freiwillig tragen, sondern weil sie es müssen – aus familiärer, sozialer oder religiöser Erwartung.
Und doch: Wer das anspricht, gilt schnell als intolerant. Wer die Ambivalenz benennt, macht sich verdächtig. Die Debatte ist vermint – nicht zuletzt, weil sie mit Fragen von Herkunft, Identität und Schuld aufgeladen ist.
Gerade deshalb ist der Artikel von Julia Ruhs so bemerkenswert. Weil er die Widersprüche benennt. Und weil er zeigt, wie wenig es heute braucht, um sich vor einer ehrlichen Debatte zu drücken – nämlich ein Smartphone, ein Hashtag, ein paar tausend Likes.
Die nächste Frage liegt in der Luft. Und sie ist unbequem: Was genau fehlt jungen Frauen in dieser Gesellschaft, dass sie sich freiwillig einem Regelwerk unterwerfen, das für viele andere nur unter Zwang gilt?
Vielleicht liegt die Antwort gar nicht im Islam selbst – sondern in der westlichen Leere, der diese jungen Frauen zu entkommen versuchen.
Eine Leere, die sich nicht nur durch Konsum und Social-Media-Selbstvermarktung zieht, sondern durch alle Ebenen des Alltags: Familien, in denen niemand mehr sagt, was gilt. Schulen, die alles verstehen, aber nichts fordern. Medien, die das Perverse feiern und die Orientierung verspotten. Medien, in denen die Lüge zur Norm wurde.
Wer mit 13 Jahren schon alles darf, wer auf Netflix in jeder zweiten Serie lernt, dass Geschlecht beliebig, Lust bedingungslos und Familie optional ist – der muss sich nicht wundern, wenn manche nach etwas anderem suchen.
Etwas mit Struktur. Mit Hierarchie. Mit einem klaren Ja und einem klaren Nein.
Und während sich Teile der Gesellschaft noch über das angeblich toxische Erbe des Christentums empören, während sie alles Religiöse aus Klassenzimmern und Gerichtssälen verbannen wollen, entdecken andere den Islam – nicht trotz seiner Strenge, sondern wegen ihr.
Der Rückzug ins Kopftuch ist dann nicht mehr Ausdruck der Unterwerfung, sondern der Wunsch nach Grenze. Er wird zur symbolischen Antwort auf eine Welt, in der alles erlaubt ist – aber nichts mehr zählt.
Das ist die stille Anklage, die in all diesen TikTok-Videos mitschwingt. Und es ist vielleicht der schärfste Vorwurf, der einer liberalen Gesellschaft gemacht werden kann: Dass ihre Freiheiten nicht mehr Orientierung stiften – sondern Orientierungslosigkeit.
Man muss kein Freund des Kopftuchs sein, um das zu verstehen. Man muss nur hinhören. So wie Julia Ruhs es getan hat.
Merz taumelt ins Kanzleramt – aber um welchen Preis? Das wahre Drama hinter dem zweiten Wahlgang
Geheim-Urteil gegen die AfD: Der Staat brandmarkt – aber die Begründung dafür verrät er uns nicht
CDU unterschreibt ihr Ende – Koalitionsvertrag macht sie endgültig zu rot-grünem Erfüllungsgehilfen
Bild: Screenshot Titok
Bitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.
Mehr zum Thema auf reitschuster.de

Sorgen in Berlin bald Polizistinnen mit Kopftuch für Ordnung?
Die Trennung von Staat und Religion hat gute Gründe. Doch damit soll bald Schluss sein. Eine Expertin bescheinigt den Grünen, eine Phantom-Debatte zu führen – und damit von den eigentlichen Problemen ablenken zu wollen. Von Kai Rebmann.

Im Stern wird Kopftuch zum „Schutz für die Frauen“ erklärt
Das Magazin bedient sich einer 14-Jährigen, um den Zwang zur Kopfbedeckung und damit die Unterdrückung der Frau schönzureden. Eine Instrumentalisierung und ein Propaganda-Werk zum Fremdschämen.
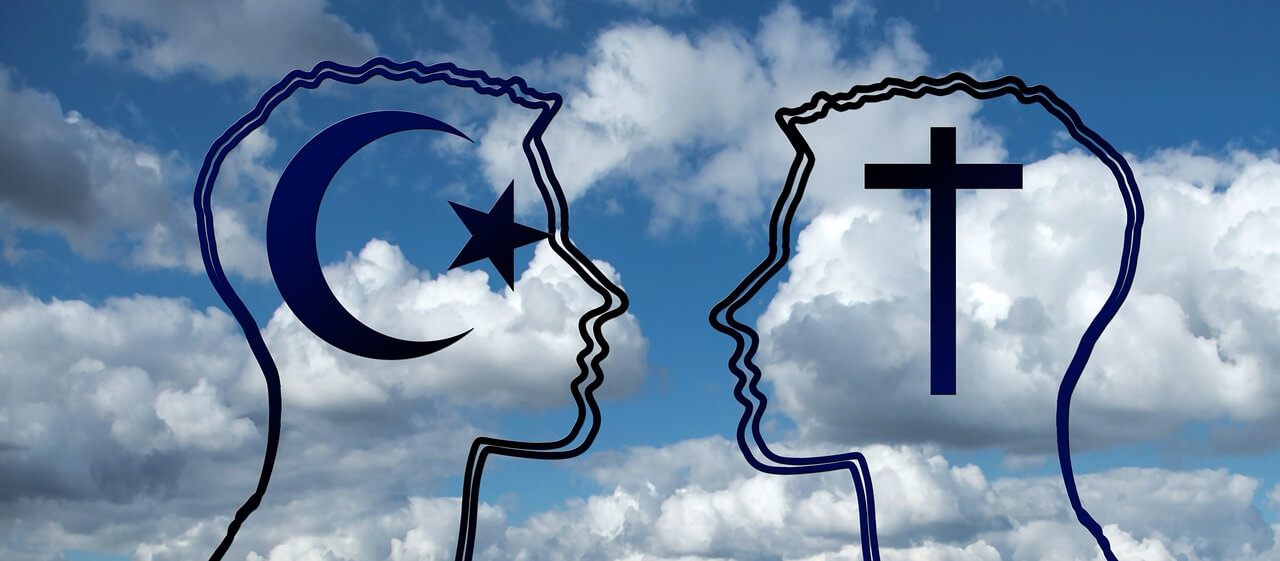
Ja zum Kopftuch, nein zum Kreuz
Gastbeitrag von Professor Felix Dirsch, katholischer Theologe und Politikwissenschaftler. Der Kampf um Identitäten im zunehmend multireligiösen Staat wird schärfer. Christliche Glaubenssymbole werden von der politmedialen Klasse, anders als islamische, durchwegs abgelehnt Unlängst machte der CDU-Ortsverband Bochum auf Facebook von sich reden. Man beglückwünschte die Muslime zu der geplanten Grünen Moschee Ruhr. Sie sei „innovativ, umweltfreundlich und verbindend“. Natürlich fehlten gute Wünsche zum Fastenbrechen nicht. Vor lauter Freude über die (in dem Bau zum Ausdruck kommende) Vielfalt vergaß man ganz, den Träger im Hintergrund unter die Lupe zu nehmen: den Islamischen Kulturverein Bochum, in dem Salafisten aus- und eingehen. Natürlich sind [weiterlesen]