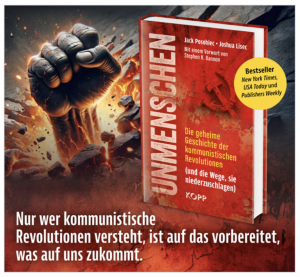Ein Gastbeitrag von Thomas Rießinger
Eine Geschichte soll ich erzählen? Lasst mich nachdenken…. Ja, über Buto will ich berichten, Buto, den Schäfer, und über Regula, die überzählige Tochter Fasos. Ihre Geschichte ist sehr lange her, und niemand weiß heute noch, ob Regula im Jubel des Stammes zur Priesterin der Holzstäbe bestellt oder unter ähnlichem, wenn auch verhaltenerem Jubel dem Fluss überantwortet wurde – aber so erzählt man nicht; ich will von vorne anfangen.
Stellt euch ein Dorf vor, an einem großen Flußlauf gelegen und daher umgeben von saftigen Wiesen, fruchtbar und zugleich schön anzusehen. Die Dorfbewohner, in landwirtschaftlichen Gebräuchen wohlbewandert, wussten die Wiesen zu nutzen, und so nannte der Stamm eine Herde von einhundertundsieben Schafen sein eigen. Wie aber Kinder nach einem Vater verlangen, um in Liebe und Strenge gedeihen zu können, so brauchte die Herde einen Schäfer – ein schweres Amt, das stets der Klügste und Weiseste des Dorfes versah, erwählt durch Götterurteil, will sagen: durch Beschau der heiligen Leber einer geweihten Ratte.
Der Tag, an dem wir einsetzen, war Trauer- und Freudentag zugleich. Lange schon gebrechlich, war der alte Schäfer gestorben, weshalb in Vorbereitung prächtiger Feierlichkeiten, deren Ziel es war, den trockenen Leichnam in gottgefällige Asche zu verwandeln, ernsten Blickes die Männer einhergingen, während die Frauen ihre Gesichter mit Holzasche bestrichen. Und doch glomm in jedem Manne ein Funke der Hoffnung, erwartete jeder voll Ungeduld das Schlachten der göttlichen Ratte: Wer konnte ein himmlisches Urteil vorausahnen oder gar den Auserwählten nennen? Keinen gab es, der nicht Gründe anzuführen wusste für seine Bestimmung, keinen, der nicht im Geheimen erwartete, aus der Leberschau als Gepriesener hervorzugehen.
Kaum war der Leichnam des alten Hirten verbrannt, so zogen sich schon die Priester zurück zum heilig-greulichen Werk. Dass dies ohne Zeugen geschah, war überlieferte, unverbrüchliche Regel; niemals durfte das Opfertier lüsternen, unvorbereiteten Blicken, die der Gefahr einer Entweihung Tür und Tor geöffnet hätten, ausgesetzt werden: die Zeremonie blieb den Priestern vorbehalten. Als sie aber zurückkehrten, Ratte und Leber feierlich aufgebahrt und noch den Widerschein göttlichen Glanzes in den Augen tragend, herrschte Stille im Dorf. Wie es das Gesetz befahl, standen die Männer, gleich welchen Alters, am Rande des Dorfplatzes, aneinandergereiht zur Form eines halben Kreises; die Ratte, Symbol der Vollkommenheit, wurde in schnellem Wurf durch die Luft geschleudert und landete vor Butos Füßen.
Er also, Buto, noch jung, doch klug und weise genug, um über alle erhoben zu werden, tatsächlich von größeren Gaben als der alte Hirte: so, sagten die Priester, habe die Leber gesprochen. Von nun an war Buto Herr über hundertundsieben Schafe – und wusste es nicht. Wir bitten dich! ruft ihr, natürlich wußte er’s; das Tier hatte zu seinen Füßen gelegen, wie konnte er’s nicht wissen? Hört aber und staunt. Bekannt war ihm und jedem im Dorf seine Berufung zum Schäfer, stolz genug trug er zu Recht sein Haupt seit jenem Tag. Dass aber gerade hundertundsieben Schafe auf der Wiese grasten, gelangte weder ihm noch einem anderen zur Kenntnis, denn sie verstanden sich nicht auf die Fertigkeit des Zählens. Fünfzig oder hundert, das galt ihnen gleichviel, man sagte „einige“ oder auch „viele“, je nach Größe und Übersichtlichkeit.
Was nun die Herde betraf, so zeigte sich hier die unglaubliche Weisheit göttlicher Ratschlüsse. Eingedenk des Mangels an Unterscheidung, der im Zuge der Worte „viele“ und „einige“ zutage trat, sammelte Buto im nahen Wald kleine Holzstäbe, viele an der Zahl, und trieb die Schafe des Morgens durch einen engen Hohlweg, eines nach dem anderen, wobei er für jedes Tier einen Holzstab in eine irdene Schale legte. Wollte er in den Abendstunden den Reichtum und Stolz seines Dorfes zurücktreiben von der Wiese zum Pferch, dann war nichts einfacher, als den gleichen Hohlweg zu begehen und die Stäbe in schöner Reihenfolge, dem Aufmarsch der Schafe entsprechend, jener wohlbehüteten Schale zu entnehmen: Gepriesen wurde Buto vom Stamm für seine Findigkeit.
Und da geschah’s. Zum wiederholten Male blökte die Herde der untergehenden Sonne entgegen, verglich Buto die große, seltsam-unbestimmbare Tierschar mit der nicht minder vielfältigen Anhäufung von Holzstäben, die schließlich alle zu seinen Füßen auf dem Boden lagen – alle, bis auf einen. Gleich einer dunklen unausgesprochenen Drohung verblieb ein letzter Stab in Butos Schale, und auch die schärfsten Augen konnten kein Schaf mehr ausmachen, dessen Erscheinen die unbedenkliche völlige Entleerung des irdenen Gefäßes erlaubt hätte.
Was hättet nun ihr getan? Sehe ich nicht in euren Augen, dass ihr den störenden Stab genommen, ihn mehrfach zerbrochen und schließlich in alle Welt verstreut hättet, nur um in Frieden Schäfer bleiben und die ungeteilte Achtung des Stammes genießen zu können? Nichts dergleichen war den unbegreiflichen Göttern gefällig, und Buto, ihr Auserwählter, wusste dies sehr wohl. „Ich will“, sagte er, während er sich auf einen großen flachen Stein setzte, „die Umstände genau bedenken, die hinter solch seltsamen Ereignissen stehen. Hinaus trieb ich die Schafe, als die Sonne aufging, und verfuhr mit den Stäben, wie ich’s ersann vor nicht zu vielen Tagen. Jetzt aber scheint ein Fehler zu bestehen in der heiligen Entsprechung von Holz und Tier, den zu finden des Schäfers und nur des Schäfers Aufgabe ist. Wenn ich es recht betrachte, finde ich eine Erklärung und noch eine: das Schaf, in schöner Gemeinsamkeit jenem geheimnisvollen Stab dort in der Schale zugehörig, ist nicht mehr vorhanden, oder der Stab, von dem zu vermuten wäre, dass er von meiner Hand an seinen Ort gelegt wurde, geriet auf andere, schwer erklärliche Weise unter seine Artgenossen. Wie nun? Bin ich nicht von größeren Gaben als der alte Hirte nach den Worten der Götter? Und hat man je gehört, ein Schaf sei aus ihm unbekannten Gründen verloren gegangen? Niemals kam Derartiges vor in den alten Tagen, woraus ich unwiderleglich schließe, dass nicht die Herde der Schafe, sondern vielmehr die Menge der Holzstäbe Unregelmäßigkeiten geheimer Natur aufweist. Zum Schluss aber: Wer allein kann Unerklärliches vollbringen, wem geht Unmögliches leicht von der Hand? Klar ist die Antwort: die Götter sind’s. Niemand als die Götter legte den Stab in meine Schale – als heiliges Symbol der Ordnung, wie ich vermute und ungesäumt den Priestern mitteilen werde.“
Mit diesen Worten verließ er den Stein, um auf den Spuren seiner blökenden Schützlinge dem Dorf entgegenzueilen. Dort herrschte große Verwirrung. Vor dem geräumigen Pferch standen, sich mühsam in Geduld fassend, die Familienoberhäupter, denen zu abendlicher Zeit vom Hirten die Schafe ihres Besitzes übergeben werden sollten, doch waren die nützlichen Tiere längst eingetroffen, als endlich mit untergehender Sonne ihr Zuchtmeister erschien. Zur Rede gestellt ließ er, der noch von göttlicher Erleuchtung erfüllt war, die Priester auf den Dorfplatz rufen und begann, vor den Kundigen zu sprechen. Von den Stäben sprach er, von der Entsprechung zwischen irdener Schale und lebendiger Herde, von seltsamen Geschehnissen und schließlich von göttlicher Erklärung, kurz: seine Gedanken, entwickelt auf dem flachen Stein unweit des Hohlweges, legte er dar in schlüssiger Weise, so dass alles Volk zufrieden war.
Zu Ende wäre nun unsere Geschichte, hätte nicht der alte Faso vor wenigen Jahren eine Tochter gezeugt, Regula mit Namen. Als nämlich im Dämmerschein des Sonnenunterganges die Schafe den Vätern der Hütten überantwortet wurden, da ging Faso vor wie folgt: Angekommen an seiner Hütte mit wenigen Schafen, die sämtlich das Kreiszeichen in ihrem Fell eingebrannt trugen, holte er seine Töchter vor den Eingang und stellte neben jedes Tier ein Kind, solange er’s vermochte. Dies vollbracht ging er zum Haus der Priester und sprach dort: „Priesterschaft und Schäfer, hört mich an! Beständiger Gewohnheit folgend, ordnete ich soeben einem jeden Schaf, das ein Kreiszeichen trägt und daher mein Eigentum ist, eine Tochter zu, ein Kind für ein Tier. Wie lange ist es schon meine abendliche Freude, den Stolz meines Alters aufgereiht zu sehen in der Abendsonne, und immer fand sich zu jeder Tochter ein Schaf, das durch ihre Gegenwart erhöht und verschönert werden konnte. Nur heute abend steht Regula, die kleine Regula, allein auf dem Platz, ohne wolligen Spielgefährten. Ehrenwerte Priester, hochbegabter Schäfer! So wie ihr das Problem der Holzstäbe zu lösen vermochtet, nehmt euch auch dieses Falles an und ergründet seine Ursachen in tiefer Weisheit.“
Fasos Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Sofort fielen die Priester in tiefe Meditation über das vorgetragene Ereignis, aus der sie nur erwachten, um in eine lange Beratung mit Buto, dem gedankenreichen Schäfer, einzutreten. Erst in den späten Stunden der Nacht erging der Befehl, die Zusammenkunftstrommeln laut und wohltönend zu schlagen, woraufhin der oberste Priester der versammelten Dorfgemeinschaft kundtat, man habe nun hinlänglich nachgedacht und beraten, es gebe eine Lösung und noch eine. Klar sei, dass das Geheimnis nicht bei den Schafen, deren Herde, wie unlängst erwiesen, Wohlordnung aufzeige, sondern bei Regula, Fasos Tochter, zu suchen sei. Entweder sei sie von guten Göttern zur Unterstützung des heiligen Holzstabes Fasos Töchterschar beigegeben worden, in welchem Fall man sie zur Priesterin der Stäbe bestellen müsse, oder die Götter der unteren Gegenden hätten sie erschaffen mit dem Ziel, die ewige Ordnung zu verwirren. Dann allerdings sei an jeden Fuß Regulas ein Stein zu binden und sie unverzüglich im Fluss zu versenken. Eine Entscheidung zwischen diesen Möglichkeiten könne nur eine Leberschau herbeiführen, die man hiermit für das Morgengrauen des nächsten Tages ankündige.
Hier endet die Überlieferung; wie die Geschichte ausging, kann euch niemand sagen. Nur eines ist sicher: die Götter waren in jedem Fall zufrieden. Und nun geht, Kinder, und fragt den Hirten dort, ob er euch ein wenig mit seiner Herde spielen lässt.
CDU unterschreibt ihr Ende – Koalitionsvertrag macht sie endgültig zu rot-grünem Erfüllungsgehilfen
„UN-fähig“ in New York: Wie Merz Baerbock peinlich nach oben rettet – und was dahinter steckt
Eine Billion neue Schulden – gesamte Union knickt feige ein! Der Bückling des Jahres vor Rot-Grün
Thomas Rießinger ist promovierter Mathematiker und war Professor für Mathematik und Informatik an der Fachhochschule Frankfurt am Main. Neben einigen Fachbüchern über Mathematik hat er auch Aufsätze zur Philosophie und Geschichte sowie ein Buch zur Unterhaltungsmathematik publiziert.
Bild: KI
Bitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.
Mehr von Thomas Rießinger auf reitschuster.de

Schwarz-Rot regiert am Volk vorbei. In die Sackgasse.
Polit-Erziehung durch Preise, Meinungskontrolle per Gesetz – und dazu ein Kinderlied als Spiegel. Wer noch Hoffnung hatte, wird enttäuscht: Der Merkel-Kurs wird konsequent fortgesetzt. Von Thomas Rießinger.

Schach: Ein Adventsmärchen vom Umgang mit der Obrigkeit
Als die Götter und Menschen sich im Schach begegnen, zeigt sich: Macht ist mehr als ein Privileg – sie ist eine Frage von List und Perspektive. Von Thomas Rießinger.

Der Mann im Knast, der uns befreit
Ein Gefangener, der wegen falscher Worte im Bau sitzt – und ein Publikum, das den Sketch für einen Skandal hält: Hallervorden bringt auf den Punkt, wie tief Satire heute gesunken ist. Doch die Reaktionen zeigen: Es war höchste Zeit.

Aggressive Attacke auf Autofahrer – nach Unfall mit Kind
Ein Kind wird angefahren, kurz darauf versammelt sich eine aggressive Menge, beschädigt das Auto, verletzt einen Beifahrer. Zur Identität der Angreifer kein Wort. Von Thomas Rießinger.

Wenn Freiheit, dann verpflichtend!
Katharina Schulze will einen „verpflichtenden Freiheitsdienst“. Was wie Satire klingt, ist politischer Ernst – und ein Lehrstück in sprachlicher Verdrehung und grüner Doppelmoral. Von Thomas Rießinger.

Änderung des Grundgesetzes: Deutschland schreibt sich um
Ein Sondervermögen mit Verfassungsrang, Klimapolitik als Staatsdoktrin und neue Spielräume für künftige Regierungen. Was bedeutet diese Grundgesetzänderung für Deutschland? Eine Analyse von Thomas Rießinger.

Kanzlerpoker in Berlin: Wer zieht die Strippen hinter den Kulissen?
Schuldenorgien, politische Manöver und ein drohender Linksruck: Welche Strategie die Koalitionäre in spe haben, und warum könnte Merz am Ende leer ausgehen? Ein Blick auf die Machtverhältnisse. Von Thomas Rießinger.

„Sondervermögen“ statt Schulden? – Die hohe Kunst der Wähler-Täuschung
Friedrich Merz und Co. hebeln die Schuldenbremse aus, während Wähler an Wahlversprechen erinnert werden, die nie eingehalten wurden. Ein Lehrstück politischer Trickserei. Von Thomas Rießinger.

Deutschland wählt – und verliert sowieso
Ob Songcontest oder Politik: Deutschland setzt auf fragwürdige Kandidaten, lässt sich von zweifelhaften Experten beraten – und landet am Ende auf dem letzten Platz. Mathematik-Professor Thomas Rießinger rechnet vor, warum.