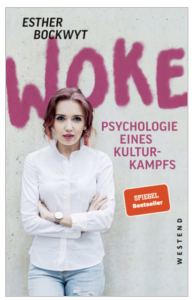Ich erinnere mich gut: Als Kind, Jugendlicher und junger Mann war für mich das „Drei Mohren“ in meiner Heimatstadt Augsburg der Inbegriff von Luxus. Das beste Hotel am Platz, im prachtvollen Fuggerschen Haus in der Maximilianstraße. Ein Ort, den ich mir nie leisten konnte, der aber Sehnsüchte weckte. Ein Fixpunkt der Stadtgeschichte, ein Symbol für Glanz. Später habe ich mich jahrelang mit einem ehemaligen Lehrer, den ich sehr schätze, unten im Café getroffen. Das war uns beiden heilig – ins „Drei Mohren” zu gehen.
Heute gibt es das „Drei Mohren” nicht mehr. Das Hotel ist geblieben – aber der Name ist weg. Unter dem Druck der Kulturkrieger wurde er auf dem Altar der politischen Korrektheit gemeuchelt und beerdigt. Aus „Drei Mohren“ wurde „Maximilian’s“. Anglisiert, geglättet, austauschbar. Für mich ist damit etwas zerbrochen – und ich setze keinen Fuß mehr hinein.
Und nicht nur mir geht es so. Jetzt ist wieder ein Stück Tradition und Heimat gestorben – in Berlin fiel die Mohrenstraße den rot-grünen Kulturrevolutionären zum Opfer. Viele Menschen – nicht nur die, die dort wohnten – wurden eines Stückes Heimat und Identität beraubt.
Denn genau darum geht es. Nicht um ein einzelnes Schild, nicht um eine harmlose Umbenennung. Sondern darum, dass uns Stück für Stück die Traditionen genommen werden, die uns geprägt haben. Ob das Café „Mohrenkopf“ in Ingolstadt, das „Mohrenfest“ in Eisenberg oder jetzt eben die Mohrenstraße in Berlin – überall das gleiche Muster. Man löscht, statt zu bewahren. Man entreißt den Menschen Orte, Namen, Symbole, die für ihr Leben Bedeutung hatten.
Wer so handelt, verändert Identität. Und das ist kein Zufall. Sozialistische Systeme wussten immer: Wer Familie, Sprache, Rituale und gewachsene Strukturen zerstört, macht die Menschen formbarer. Deshalb verschwanden im sowjetischen Block alte Straßennamen, Kirchen wurden zu Kulturhäusern, Städte erhielten neue Bezeichnungen, die sich gefügig in die Ideologie einreihten. In der DDR hießen Straßen plötzlich nach Karl Marx oder Ernst Thälmann, ganze Stadtteile wurden umetikettiert, bis kaum mehr etwas an die Vergangenheit erinnerte.
Auch im Nationalsozialismus, der nicht umsonst das Wort „Sozialismus“ im Namen trug, obwohl dieser Teil der Nazi-DNA heute tabuisiert wird, funktionierte das ähnlich. Aus der Berliner Kaiser-Wilhelm-Straße wurde die Hermann-Göring-Straße. Aus dem Königsplatz in München wurde der „Platz der Bewegung“. Die Methode war stets die gleiche: Geschichte tilgen, Symbole austauschen, Identität umprogrammieren. Wer die Sprache kontrolliert, kontrolliert die Erinnerung.
Heute wird dieses Muster fortgesetzt – nur unter rot-grünen statt roten oder braunen Vorzeichen. Die Mohrenstraße ist jetzt die Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Ein Gelehrter, der Anerkennung verdient – aber nicht auf diese Weise. Man ehrt ihn nicht, man missbraucht ihn. Sein Name wird zum Werkzeug in einem politischen Kulturkampf, der alte Begriffe brandmarkt, als seien sie toxisch.
Das Absurde: Viele Menschen mit afrikanischem Hintergrund zucken über die Debatte nur mit den Schultern. „Mohr“ beleidige sie nicht, sagen sie. Aber deutsche Moraleliten wissen es besser. Sie definieren, was verletzend zu sein hat – und schaffen damit eine künstliche Empfindlichkeit, die es ohne sie nie gegeben hätte.
Stattdessen gäbe es genug echte Probleme in Berlin: Kriminalität, Verwahrlosung, Drogenhölle am Kotti. Doch für die Politik ist es wichtiger, Straßenschilder zu tauschen. Kostenpunkt: Hunderttausende Euro für neue Schilder, Briefköpfe, Adressänderungen. Geld, das man auch in Schulbücher, Spielplätze oder Polizeipräsenz stecken könnte.
Doch so ist das Wesen aller Sprach- und Kulturreinigungen: Sie geben sich moralisch erhaben, sind aber in Wahrheit eine Entmachtung der Bürger. Man nimmt ihnen ihre gewachsenen Bezüge und ersetzt sie durch künstliche Narrative. Die Folge: ein Volk ohne Geschichte, ohne Wurzeln, ohne Identität.
Die Menschen aber vergessen nicht so leicht. Wer künftig in Berlin ein Taxi nimmt, wird weiter sagen: „Zur Mohrenstraße, bitte.“ Und dann hinterherschieben: „Ach ja, offiziell heißt sie jetzt anders.“ Das zeigt die ganze Absurdität. Man kann Straßenschilder austauschen – Identität aber nicht.
Vielleicht ist das das eigentliche Vermächtnis dieser Aktion: Dass eine Gesellschaft, die einst Goethe, Schiller und Humboldt hervorbrachte, heute stolz ist, wenn sie Straßenschilder austauscht. Fortschritt per Farbeimer.
Und doch gibt es Hoffnung. Als ich als junger Mann zum Studium in die Sowjetunion kam, fanden dort gerade die Rückumbenennungen statt. Der sozialistische Wahnsinn wurde Schritt für Schritt rückabgewickelt. Meine große Hoffnung ist, dass ich das auch in Deutschland noch erlebe.
So wird Demokratie zur Farce: Gericht stoppt AfD-Kandidat, sichert SPD-Sieg und entmündigt Wähler
Ballweg, Parfüm und eine Hundematte: Wie aus 19,53 Euro ein medialer Schuldspruch konstruiert wurde
„Nie wieder“ war gestern: Der Fall Leandros zeigt, wie moralische Säuberung wieder schick ist
Bild: Achim Wagner / Shutterstock.com
Bitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.
Mehr zum Thema auf reitschuster.de

Was noch so alles an „kultureller Aneignung“ verboten werden könnte
Bloß keine „kulturelle Aneignung“ durch weiße Menschen! Warum, weil das Kolonialismus 2.0 wäre. Also Schluss mit Winnetou, Indianerkostüm, Rastalocken. Eine (Real-)Satire von Josef Kraus.

Pfui! Igitt! Falsches Wort! „Mohrenkopf“-Skandal bei der ARD
Weil Roland Kaiser den Udo-Jürgens-Hit „Aber bitte mit Sahne“ mit dem Originaltext aus dem Jahr 1971 singt, hyperventiliert die ARD – und auch konservative Medien. Warum? Ein Sittengemälde aus einem Irrenhaus.

Café Mohrenkopf in Ingolstadt soll Namen ändern
In Ingolstadt ist ein harmlos anmutendes Bistro ins Visier der selbsternannten Gutmenschen geraten. Das Café Mohrenkopf wurde von den grünlinken Zensoren als vermeintliches Symbol des struktuellen Rassismus in der Audi-Stadt ausgemacht. Von Kai Rebmann.