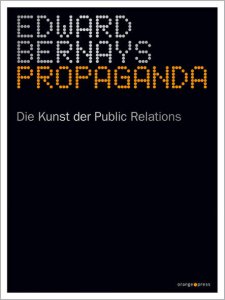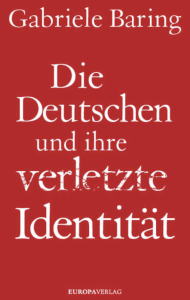Ein Gastbeitrag von Thomas Rießinger
Nun liegt das Gespräch zwischen Elon Musk und Alice Weidel einige Tage zurück und erstaunlicherweise existiert die Welt immer noch, ja sogar „unsere Demokratie“, die von den üblichen Verdächtigen so gerne in Beschlag genommen wird, treibt immer noch ihre Blüten – man konnte es beim Parteitag der AfD in Riesa beobachten, als die Hüter „unserer Demokratie“ in guter terroristischer Tradition ihre demokratischen Vorstellungen an den Tag legten. Übermäßig ergiebig war das Gespräch nicht, man erfuhr nicht viel Neues und wer zwischenzeitlich eine Pause einlegte, um Rotwein aus der Küche zu holen, dürfte kaum etwas verpasst haben.
Doch in eine Stelle verbeißen sich „unsere Demokraten“, eine Äußerung Weidels treibt ihnen die Zornesröte ins Gesicht und den Schweiß auf die Stirn. Hitler, so sagte Weidel, „war ein Kommunist und betrachtete sich selbst als Sozialist,“ man habe die gesamte Industrie verstaatlicht, Hitler sei „ein kommunistischer, sozialistischer Typ“ gewesen. Die Aufregung ist groß, die Argumente, soweit vorhanden, sind unterschiedlich. In der „Welt“ konnte man die Auffassung des Historikers Jens-Christian Wagner lesen, es sei schon deswegen „an Absurdität überhaupt nicht zu überbieten, Hitler als Kommunisten zu bezeichnen“, weil er Kommunisten in Konzentrationslager habe sperren lassen. Folgt man dieser Logik, so darf man auch Stalin nicht mehr als Kommunisten bezeichnen, jenen Stalin, der Kommunisten in Lager sperren und ermorden ließ, wie es ihm behagte – und so etwas kann man Kommunisten ja anscheinend nicht unterstellen. Man müsste dann auch Hitler selbst vom Vorwurf nationalsozialistischer Gesinnung freisprechen, denn wie schon die angebliche Niederschlagung des ebenso angeblichen Röhm-Putsches zeigte, bereitete es ihm keine Schwierigkeiten, Nationalsozialisten verhaften, einsperren und ermorden zu lassen. Bei der Welt glaubt man wohl, das gehe nur, wenn unterschiedliche Ideologien aufeinander prallen.
Die Tagesschau dagegen hat einen Historiker aufgetrieben, der bezeugt, „Hitler selbst habe im Jahr 1928 erklärt, dass seine Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) nicht sozialistisch sei“. Allerdings sagte er auch unmittelbar nach der Machtübernahme im Kreis von Generälen: „Ich bin auch Sozialist, weil ich glaube, dass damit dem Nationalsozialismus am besten gedient ist. Die Wehrmacht ist die grandioseste sozialistische Einrichtung.“ Und noch 1942 versicherte er, aus dem Russlandfeldzug sei noch keiner zurückgekehrt ohne die Überzeugung, „dass, wenn überhaupt ein sozialistischer Staat irgendwo in der Verwirklichung begriffen war, dies nur in Deutschland allein geschah“. Das mag man nun für passend halten oder nicht, am Selbstzeugnis ändert das nichts.
Es gibt bessere Argumente gegen Weidels These und sie verdienen Beachtung. Kommunisten pflegen sich in aller Regel auf Marx zu berufen, insbesondere auf seine sonderbare Vorstellung, das eherne Gesetz der Geschichte erkannt zu haben, die zwangsläufig auf die proletarische Revolution hinauslaufe, und auf seine Idee der Verstaatlichung der Produktionsmittel. Die erste Vorstellung wird man bei Hitler nicht finden und die Verstaatlichung im großen Stil hat zumindest vor dem Krieg nicht stattgefunden – oberflächlich betrachtet. Darauf werde ich noch zurückkommen.
Zunächst will ich aber einen Zeugen zitieren, der rechtsextremer Umtriebe wohl kaum verdächtig sein dürfte: Kurt Schumacher, erster Vorsitzender der SPD nach dem zweiten Weltkrieg und aus eigener leidvoller Erfahrung ausgesprochen vertraut mit den Praktiken der Nationalsozialisten. Er kannte sie schon früh und hat sie schon früh eingeschätzt: Die Kommunisten, sagte er 1930, seien nur „rot lackierte Doppelausgaben der Nationalsozialisten“. Auch nach dem Krieg bezeichnete er Kommunisten als „rot lackierte Faschisten“ und wies darauf hin, „dass zum Beispiel die Schalmeienkapelle des Rotfront-Kämpfer-Bundes in Berlin-Lichtenberg geschlossen zur SA übergegangen“ war“ und genauso begeistert auf Sozialdemokraten einprügelte wie vorher. Das sind Worte eines Kenners sowohl der Nationalsozialisten als auch der Kommunisten, man sollte sie nicht einfach vom Tisch wischen. Sicher, der Gedanke einer zwangsläufig stattfindenden proletarischen Revolution war den Nationalsozialisten eher fremd, aber die Methoden der Kommunisten übernahmen sie gerne – und umgekehrt.
Auch ein zweiter unverdächtiger Zeuge sollte zu Wort kommen. Es handelt sich um Sebastian Haffner, dessen Buch „Anmerkungen zu Hitler“ von 1978 immerhin als preiswürdig angesehen und in mehrere Sprachen übersetzt wurde; rechtsextreme Bestrebungen hat ihm wohl niemand vorgeworfen oder vorwerfen können. Über die konservative Opposition gegen Hitler liest man dort: „Es war die einzige Opposition, die ihm bis zum Schluss zu schaffen machte; die einzige, die eine, wenn auch geringe Chance hatte, ihn zu Fall zu bringen, und die wenigstens einmal auch den Versuch dazu machte. Und diese Opposition kam von rechts. Von ihr aus gesehen stand Hitler links. Das gibt zu denken. Hitler ist keineswegs so leicht als extrem rechts im politischen Spektrum einzuordnen, wie es viele Leute heute zu tun gewohnt sind.“ Immerhin vertritt hier ein renommierter Zeitzeuge die Auffassung, Hitler habe aus der Sicht der Konservativen, der „Rechten“, links gestanden und seine Einordnung in das beliebte Links-Rechts-Schema sei problematisch. Vermutlich wird man sein Buch bald auf den Index setzen.
Und es geht noch weiter. „Wer mit Marx das entscheidende oder sogar das alleinige Merkmal des Sozialismus in der Sozialisierung der Produktionsmittel sieht, wird diese sozialistische Seite des Nationalsozialismus natürlich ableugnen. Hitler hat keine Produktionsmittel sozialisiert, also war er kein Sozialist: Damit ist für den Marxisten alles erledigt. Aber Vorsicht! So einfach ist die Sache nicht.“ Denn auch die sozialistischen Staaten haben alles darangesetzt, die Menschen zu sozialisieren, „also sie, möglichst von der Wiege bis zur Bahre, kollektiv zu organisieren und zu einer kollektiven, ’sozialistischen‘ Lebensführung zu nötigen, sie ‚fest in eine Disziplin einzuordnen‘. Es fragt sich durchaus, ob das nicht, trotz Marx, die wichtigere Seite des Sozialismus ist.“
‚Hitler war darin unzweifelhaft Sozialist‘
Haffner begründet diese Parallele mit einem Vergleich des Lebens im NS-Staat mit dem in der 1978 noch quicklebendigen DDR, den ich im Folgenden ohne Unterbrechungen zitiere. „Worin sich das Leben der riesigen Mehrheit von Deutschen, die keine rassisch oder politisch Ausgeschlossenen und Verfolgten waren, im Dritten Reich von dem Leben im vorhitlerischen Deutschland und auch von dem in der Bundesrepublik unterschied, worin es aber dem Leben in der DDR gleicht wie ein Ei dem andern, das war, dass es sich zum allergrößten Teil in außerfamiliären Gemeinschaften oder Kollektiven abspielte, an denen für die meisten, ob die Mitgliedschaft nun offizieller Zwang war oder nicht, praktisch kein Vorbeikommen war. Das Schulkind gehörte zum Jungvolk wie heute in der DDR zu den Jungen Pionieren, der Heranwachsende fand ein zweites Zuhause in der Hitlerjugend wie in der Freien Deutschen Jugend, der Mann im rüstigen Alter trieb Wehrsport in der SA oder SS wie in der Gesellschaft für Sport und Technik, die Frau betätigte sich in der Deutschen Frauenschaft (dem Demokratischen Frauenbund), und wer es zu etwas gebracht hatte oder bringen wollte, gehörte in die Partei, damals im Dritten Reich wie heute in der DDR; von den hunderterlei nationalsozialistischen beziehungsweise sozialistischen Berufs-, Hobby-, Sport-, Bildungs- und Freizeitvereinigungen (Kraft durch Freude! Schönheit der Arbeit!) nicht zu reden. Selbstverständlich, die Lieder, die gesungen, und die Reden, die gehalten werden, waren damals im Dritten Reich andere als heute in der DDR. Aber die Beschäftigungen – das Wandern, Marschieren und Kampieren, das Singen und Feiern, das Basteln, Turnen und Schießen – waren nicht zu unterscheiden, ebensowenig die unleugbaren Geborgenheits-, Kameradschafts- und Glücksgefühle, die in solchen Gemeinschaften gedeihen. Hitler war darin unzweifelhaft Sozialist – ein sehr leistungsstarker Sozialist sogar –, dass er die Menschen zu diesem Glück zwang.“
Ich darf wiederholen: „Hitler war darin unzweifelhaft Sozialist“, er hat die Menschen sozialisiert, wie man es später in der DDR beobachten konnte, in den Methoden gibt es keine übermäßigen Unterschiede.
Doch auch Haffner räumt ein: „Von Stalins ‚Sozialismus in einem Lande‘ unterschied sich Hitlers ‚Nationalsozialismus‘ (man beachte die terminologische Identität!) freilich durch das weiter bestehende Privateigentum an Produktionsmitteln, für Marxisten ein gravierender Unterschied. Ob er in einem totalitären Befehlsstaat wie dem Hitlerschen wirklich so gravierend ist, bleibe dahingestellt.“ Man muss es nicht dahingestellt sein lassen. Es stimmt, die offizielle Verstaatlichung der Produktionsmittel war Hitlers Sache nicht. Die faktische schon und auf das Etikett kommt es nicht an. Ludwig von Mises, ein Wirtschaftswissenschaftler aus der „Österreichischen Schule“ der Nationalökonomie und Theoretiker des liberalen und libertären Denkens, hat darauf schon 1942 in einem Brief an die New York Times hingewiesen: „Das deutsche Modell des Sozialismus (Zwangswirtschaft) zeichnet sich dadurch aus, dass es, wenn auch nur nominell, einige Einrichtungen des Kapitalismus beibehält. Die Arbeit ist natürlich keine ‚marktgängige Ware‘ mehr; der Arbeitsmarkt ist feierlich abgeschafft worden; die Regierung legt die Lohnsätze fest und weist jedem Arbeiter den Ort zu, an dem er arbeiten muss. Das Privateigentum ist nominell unangetastet geblieben. Tatsächlich aber sind die ehemaligen Unternehmer auf den Status von Betriebsführern reduziert worden. Die Regierung schreibt ihnen vor, was und wie sie zu produzieren haben, zu welchen Preisen und von wem sie einkaufen und zu welchen Preisen und an wen sie verkaufen sollen. Die Unternehmen können gegen unbequeme Anordnungen protestieren, aber die endgültige Entscheidung liegt bei den Behörden.“
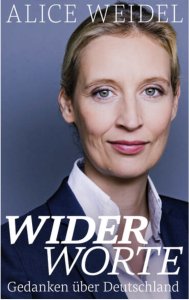
Nominell war das Wirtschaftssystem des NS-Staates ein kapitalistisches, das Privateigentum blieb „nominell unangetastet“. In der Praxis hatte die Wirtschaft aber zu tun, was der Staat, was die Regierung ihr vorschrieb: „Die endgültige Entscheidung liegt bei den Behörden.“ In der „Welt“ hatte der gleiche Jens-Christian Wagner, den ich schon oben zitiert habe, geäußert: „Nie haben die Nazis auch nur einen Deut an der marktwirtschaftlichen und der kapitalistischen Grundverfassung des Wirtschaftssystems in Deutschland geändert.“ Dieser Satz dürfte vielleicht ein wenig korrekturbedürftig sein. Eben jener Herr Wagner hat übrigens im Januar 2023 Hans-Georg Maaßen vorgeworfen, er habe in den antisemitischen Giftschrank gegriffen, weil er von einem eliminatorischen Rassismus gegen Weiße gesprochen und durch die Verwendung des Wortes „eliminatorisch“ einen Bezug zum Holocaust hergestellt habe. Deutschland kann sich vieler Experten rühmen, von Christian Drosten bis hin zu Jens-Christian Wagner.
Kurt Schumacher, Sebastian Haffner, Ludwig von Mises – sie alle sahen deutliche Parallelen zwischen dem Nationalsozialismus und dem Sozialismus marxistischer Prägung. Haffner hat deutlich gemacht, dass Hitler in den Augen eines Konservativen der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts ein Linker war. Das alles beweist keine Gleichheit, aber belegt doch eine beträchtliche Strukturähnlichkeit, die selbstverständlich interessierten Kreisen nicht behagt. Weidels und Musks Aussagen waren zu stark vereinfacht. Aber die von einsetzender Schnappatmung geprägte Kritik und Verteufelung hat mit Freude wesentliche Aspekte und wesentliche Auffassungen übersehen.
Wir sind es nicht anders gewöhnt.
Musk, Macht und die Zukunft: Wer prägt 2025? Und beginnt jetzt endlich der Abgesang auf Rot-Grün?
Magdeburg: Terror, Behördenversagen, Fragen, die niemand stellt und unbequeme Fakten, die verstören
Merz – die finale Selbstkastration und Unterwerfung der „Opposition“ unter die rot-grüne Agenda
Gastbeiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können.
Thomas Rießinger ist promovierter Mathematiker und war Professor für Mathematik und Informatik an der Fachhochschule Frankfurt am Main. Neben einigen Fachbüchern über Mathematik hat er auch Aufsätze zur Philosophie und Geschichte sowie ein Buch zur Unterhaltungsmathematik publiziert.
Bild: KI
Bitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.
Mehr von Thomas Rießinger auf reitschuster.de
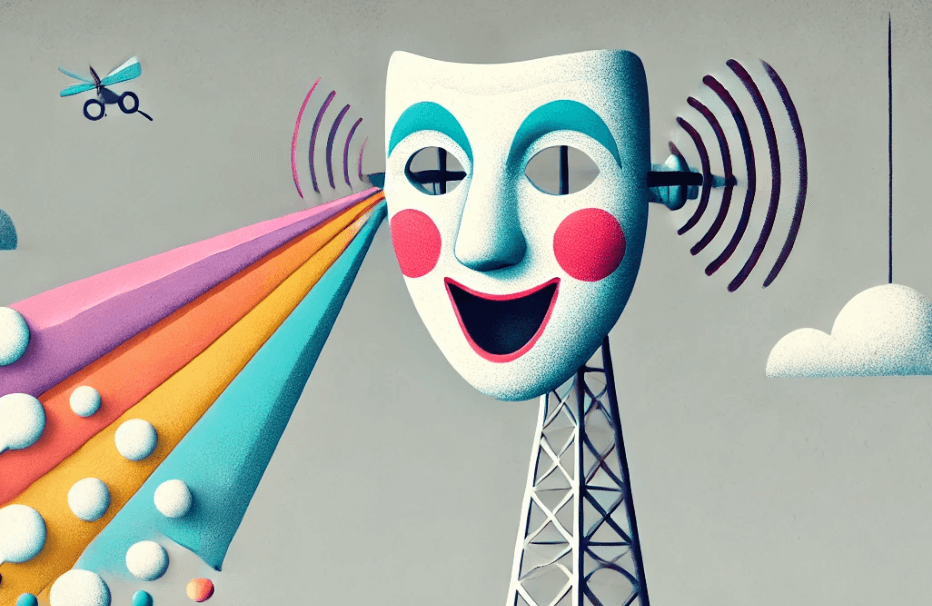
Deutschlandfunk Kultur: Neujahrswünsche mit versteckter Botschaft
Mit seinen Neujahrswünschen blamiert sich der öffentlich-rechtliche Sender selbst: Weder hält er seine Hörer für mündige Bürger, noch etwas von der Meinungsfreiheit. Von Thomas Rießinger.

Musk tut, was deutsche Politiker längst tun – doch bei ihm empört es
Deutsche Politiker mischen sich in internationale Wahlkämpfe ein, doch ein Milliardär wird zum Problem erklärt. Ist Meinungsfreiheit nur für die „richtigen“ Meinungen erlaubt? Von Thomas Rießinger.

Gegen das Vergessen: Wie ein Unfallopfer zum Corona-Toten wird
Der Schweizer Präsident Cassis sorgte 2022 mit einer absurden Erklärung zur Zählweise von Corona-Toten für Aufsehen. Die Lehren daraus sind aktueller denn je. Von Thomas Rießinger.

Respekt oder Zeitgeist? Die Universität Paderborn und der Fall Krötz
Die Causa Krötz geht in die nächste Runde: Ein Statement der Universität Paderborn zeigt eine neue Dynamik – und enthüllt Widersprüche zwischen verkündeten Werten und tatsächlichem Handeln. Von Thomas Rießinger.
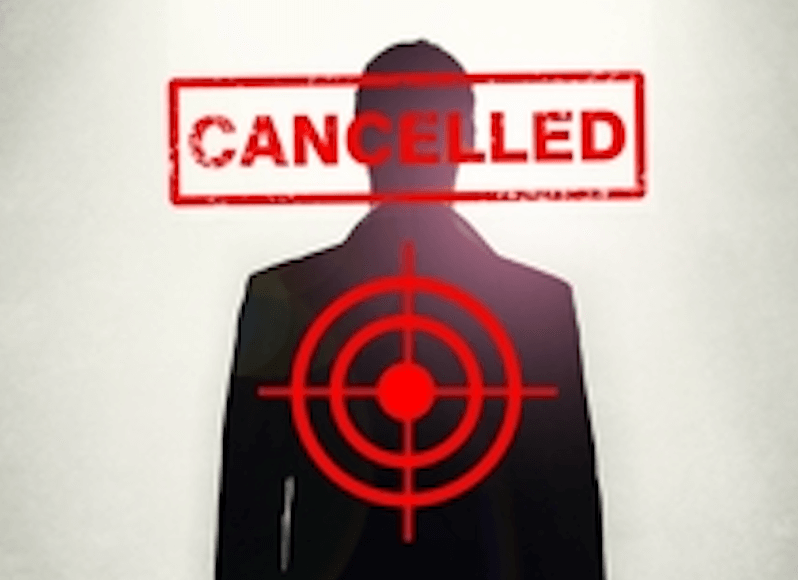
Ein Wort zu viel – und der Zeitgeist explodiert
Ein harmloses Zitat, ein alter Kinderreim – und ein Shitstorm nimmt seinen Lauf. Bernhard Krötz steht plötzlich im Zentrum einer Debatte, die mehr über ihre Kritiker sagt als über ihn. Von Thomas Rießinger.

Schach: Ein Adventsmärchen vom Umgang mit der Obrigkeit
Als die Götter und Menschen sich im Schach begegnen, zeigt sich: Macht ist mehr als ein Privileg – sie ist eine Frage von List und Perspektive. Von Thomas Rießinger.

Wenn Meinung zur Gefahr wird: Der Song, der ins Schwarze trifft
Ein Lied, das kein Blatt vor den Mund nimmt: Der Sänger thematisiert mutig, wie Kritiker systematisch mundtot gemacht werden. Ein musikalischer Aufruf zum Nachdenken. Von Thomas Rießinger.

Was passiert mit dem CO₂-Ausstoß, wenn sich Deutschland plötzlich abschafft?
Ein Deutschland ohne CO₂-Emissionen? Wie schnell der Rest der Welt den deutschen Beitrag kompensiert und warum das Klima davon unbeeindruckt bleibt, zeigt eine Modellrechnung von Thomas Rießinger.

Gerechtigkeit à la Linke: Bußgelder behalten, Ideologie bewahren?
Die Debatte um die Einstellung von Corona-Bußgeldverfahren legt erneut den verzerrten Gerechtigkeitssinn der Linken offen. Regelkonformität wird über echte Fairness gestellt. Von Thomas Rießinger.

Das Heizungsgesetz: Ein Spiel aus Farce und Täuschung
Die Union will das Heizungsgesetz nach Neuwahlen kippen. Ein echtes Vorhaben oder nur Wahlkampfgetöse? Warum Spahns Worte mehr Theater als Substanz sind. Von Thomas Rießinger.