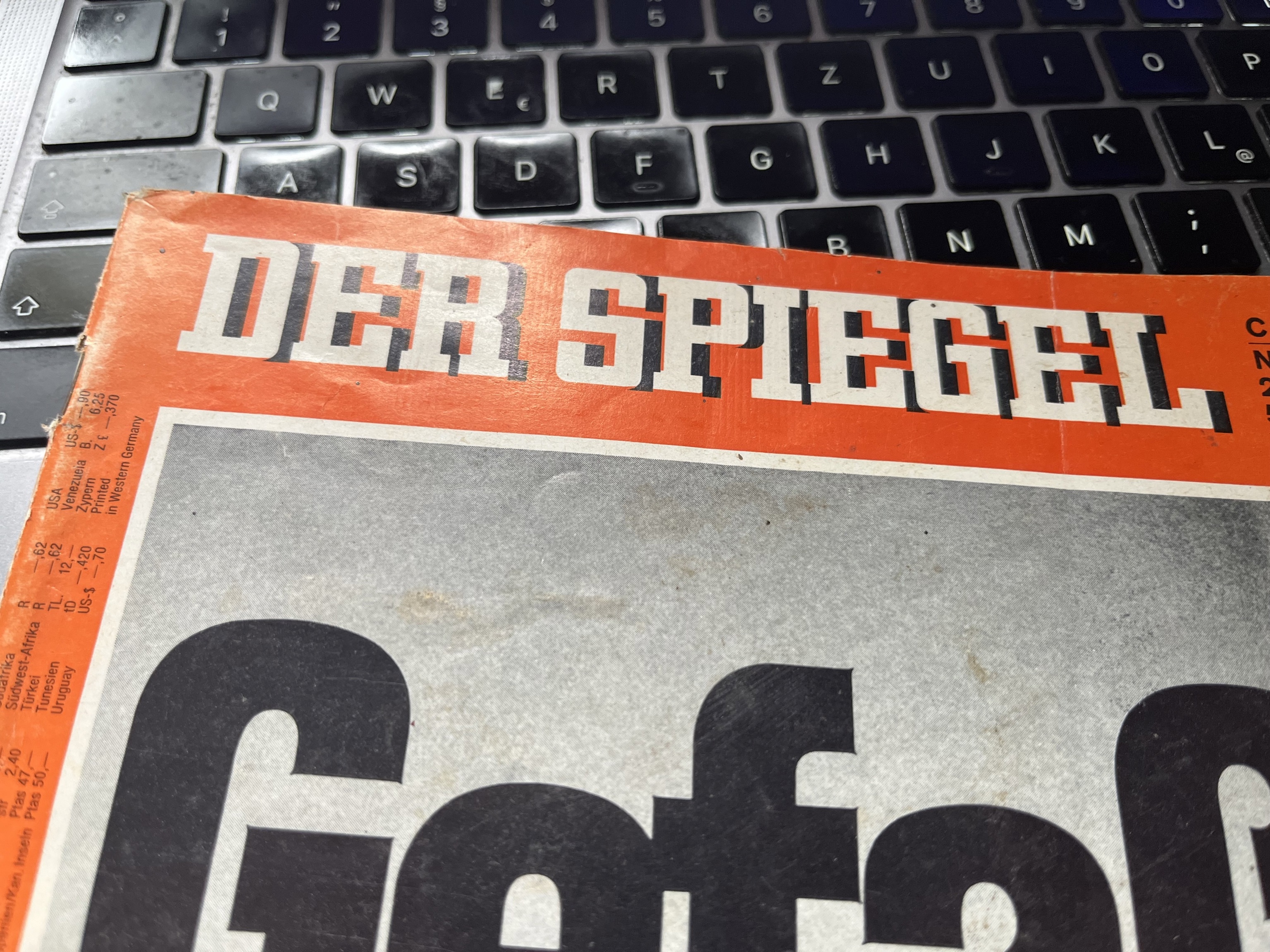Leider kein Scherz, sondern ernst gemeint: Der Spiegel lässt Gastautor Bernhard Pörksen hinter der Bezahlschranke darüber befinden, ob der Spiegel noch Qualitätsjournalismus macht. Und Pörksen prahlt dann mit der Belegkraft von über 501 Seiten Interview, die er in der Spiegel-Redaktion gemacht habe – 1001 Dalmatiner in der Sparversion.
Obendrauf beginnt diese überlange Geschichte – ein Hybrid aus launiger Erzählung und Küchenpsychologie – auch noch damit, dass der Autor von einem offenbar befreundeten Ex-Spiegel-Redakteur eine Mail bekommt, die sich kritisch mit dem Spiegel befasst.
Ja, das klingt alles so haarsträubend, wie es ist. Und die These, die am Ende dabei herauskommt, nämlich dass beim Spiegel noch alles voll in Ordnung sei, wird schon von der Konstruktion dieses Greenwashings des für den Spiegel über den Spiegel schreibenden Medienwissenschaftlers Bernhard Pörksen ad absurdum geführt.
Was sich das Magazin hier hat zusammenbasteln lassen, ist schon arg peinlich. Anstatt sich wissenschaftlich – oder wenigstens populärwissenschaftlich – mit den Veröffentlichungen des Magazins auseinanderzusetzen, berichtet Pörksen von vielen gemütlichen Plauderstunden am Kaffeeautomaten in der Spiegel-Redaktion. Die Absätze wirken so Zeile für Zeile mehr wie die Rechtfertigung einer Schlechtleistung mit den Bedingungen in der Redaktion: Ein Redakteur kommt gerade vom Sport und will wissen, ob er noch duschen kann, bevor er sich an den Rechner setzt und lostackert.
Was will der Autor damit sagen? Dass man schon entschuldigen muss, dass so nichts Perfektes herauskommen kann? Für die, die es nicht bis zum Ende schaffen, nimmt Bernhard Pörksen sein Fazit vorweg: Die böse Kritik am Spiegel wolle „nicht verbessern, sondern diffamieren“.
Die Begründung des Medienwissenschaftlers wird zum Gefälligkeitsoffenbarungseid: Zum einen fehle die konkrete Redaktionsbeobachtung, die Nähe zum medialen Feld, zum anderen aber mangele es an einem systemischen Verständnis all der Kräfte, „die den seriösen Journalismus unter Druck setzen wie nie zuvor.“ Hier also einmal mehr die Rechtfertigung der kritisierten Veröffentlichungen über die Mühsal der Schaffenden im Hintergrund. Es ist jämmerlich, der Schreiner entschuldigt den wackelnden Stuhl mit der schlechten Holzqualität.
Weil Pörksen aber nicht nur Kumpel ist, sondern auch Medienwissenschaftler, dürfen die üblichen Binsen nicht fehlen:
„Die Vernetzung der Welt, nach der Erfindung von Schrift und Buchdruck die dritte große Kommunikationsrevolution der Menschheitsgeschichte, ist inzwischen Realität.“
Das will so sehr Daniel Kehlmann sein, dass es weh tut. Aber zunächst einmal werden die Kritiker des Spiegels abgebügelt: Die „fuchtelnde Rechthaberei“ dieser Leute krankt, so Pörksen, an einem doppelten Defizit:
„Zum einen fehlt die konkrete Redaktionsbeobachtung, die Nähe zum medialen Feld, zum anderen aber mangelt es an einem systemischen Verständnis all der Kräfte, die den seriösen Journalismus unter Druck setzen wie nie zuvor.“
Da wird also schnell mal ein Ansatz aus der Systemtheorie hervorgekramt und dem Kritiker generell die Fähigkeit abgesprochen, komplexe Zusammenhänge und Wechselwirkungen innerhalb eines Systems zu erkennen und zu verstehen. Und damit es jeder versteht, legt Pörksen noch einen nach: Das „Lügenpresse-light-Geraune“ sei inzwischen „so sehr in Mode“ gekommen.
Und das ist dann die berühmte Erbse unter der Matratze, die alles, was der Medienwissenschaftler dann darüber bettet, so drückend macht: Bernhard Pörksen, der so viele Stunden am Kaffeeautomaten in der Ericusspitze 1 mit den Spiegel-Redakteuren verplaudert haben will, lässt unerwähnt, dass das „Lügenpresse“-Geraune eine Erfindung des Spiegels selbst ist – und zwar in der historischen Tradition des Schimpfwortes gegen eine andersdenkende vierte Gewalt.
„Lügenpresse“ in der Kreation des Spiegels findet sich seit einer Dekade in fast jeder Beschreibung der neuen Medien wieder. Wer regierungskritisch berichtet, der wird vom „Spiegel“ als ein rechtspopulistisches Medium aus dem Umfeld der AfD markiert. Wer regierungskritisch berichtet, der wird vom „Spiegel“ als „umstritten“ markiert.
So wie es Pörksen hier macht, hatte es 2015 schon einmal Jan Fleischhauer versucht, als der noch beim Spiegel schrieb:
„Wenn man auf den Punkt bringen soll, was die Verächter des ‚Mainstream-Journalismus‘ verbindet, dann ist das der Zorn auf die da oben. Früher waren ‚die da oben‘ die Politiker oder die Reichen, jetzt sind es auch die arrivierten Journalisten.“
Mit hochgezogener Augenbraue bezeichnet Fleischhauer die neuen Medien als einen als „Selbstermächtigung gefeierten Bürgerjournalismus“.
Für den Autoren sind die vorlauten neuen Journalisten außer Kontrolle geraten. Für sie gebe es „keinen Verhaltenskodex und auch keinen Presserat, bei dem man sich beschweren könnte“. Das war 2015. Mittlerweile ächzen die neuen Medien unter den Nachstellungen der Landesmedienanstalten. Und der Presserat hat sich als Feigenblatt der regierungsnahen Medien und ihrer Verbände herausgestellt. Rügen werden nicht einmal mehr abgebildet, wenn man keinen Bock darauf hat – Sanktionen Fehlanzeige.
Mit einem Wort: Die wachsende Kritik an der Arbeit des Spiegels, die der befreundete Medienwissenschaftler des Magazins hier so opulent von der Platte wischen will, geht einher mit dem hysterischen Wegtreten all jener Kritiker der Regierung, welcher man sich so nahe fühlt. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass das Magazin nichts dabei findet, sich – und ausgerechnet während der Corona-Jahre – Millionen aus dem Köfferchen von Bill Gates schenken zu lassen.
Findet beim Autor alles nicht statt. Eine notwendige fundierte Analyse der Kritik am Spiegel findet nicht statt. Stattdessen beklagt Bernhard Pörksen voll von Mitgefühl, dass es früher beim Spiegel für eine gute Story eine große Pulle Champagner vom Boss gab, wie er am Kaffeeautomaten – oder hingeflüstert im „Newsroom“ – erfahren haben will.
Der Champagner habe beispielsweise gefehlt nach der Veröffentlichung zum 1100 Seiten umfassenden Verfassungsschutz-Gutachten, schreibt Pörksen. Das sei eine „klassische SPIEGEL-Enthüllung“ gewesen, an der in einer Nachtschicht vier Redakteure gearbeitet hätten.
Tatsächlich war das einer der Tiefpunkte des etablierten Journalismus, als Innenministerin Nancy Faeser zwei Tage vor ihrem Ausscheiden aus dem Amt die Verfassungsschutz-Einstufung der AfD als rechtsextrem mit 1100 Seiten begründete, die aber niemand sehen sollte.
Später bekam sie dann rein zufällig der Spiegel zugespielt, und Pörksen nennt das eine „klassische SPIEGEL-Enthüllung“? Das Papier, das sich schnell als Windbeutel und überwiegend pomadige Google-Recherche oder KI-Sammlung von Einzelaussagen von AfD-Politikern entpuppen sollte, wurde vorab vom „Spiegel“ vorgestellt (der vermutlich gezielt lancierte Leak an das regierungsnahe Medium hat sich gerechnet), als sei man die Bundespressestelle des Verfassungsschutzes.
Die Spiegel-Redaktion im „Kampf gegen Rechts“, und für den Medienwissenschaftler eine Veröffentlichung, die für „Furore“ gesorgt hat.
Oder doch, an einer Stelle geht Pörksen fernab vom Kaffeeautomaten in die direkte Kritik eines Spiegel-Artikels, da schreibt er von einem „glänzend recherchierten Bericht von einer Klimakonferenz am Ende der Welt“.
Der Spiegel versuche doch immer Flüchtigkeitsfehler „nach Kräften zu vermeiden“, wo es um die Frage der Sorgfalt im Umgang mit Eilmeldungen geht. Nein, hier findet Relotius nicht statt, er war über Jahre der Münchhausen der Spiegel-Reportagen.
Aber dass heute kleinere Redaktionen wie etwa „Apollo News“ jede Eilmeldung schneller seziert haben als der dickfellige Spiegel, der zudem noch jede Meldung regierungsnah abschmelzen muss, findet bei Pörksen ebenfalls nicht statt. Keine Untersuchung der Frage, warum – mutmaßlich – der Spiegel immer öfter die neuen Medien zitieren muss als Erstmelder, nur um diese dann im selben Atemzug rechtspopulistisch zu diffamieren: Die Ex schimpft die neue Geliebte eine Hure – oder so ähnlich.
Aber der Medienwissenschaftler bleibt davon vollkommen unbeirrt – Ja, es ist alles sehr peinlich:
„Mein Befund: DER SPIEGEL kann, wie kaum ein anderes Medium, auf unplanbare Schreckensereignisse mit gewaltiger publizistischer Wucht und präzisen Sofortrecherchen reagieren.“
Peinlichkeit reiht sich an Peinlichkeit, das sind allenfalls exzellente Regieanweisungen für einen Reporterporno:
„Fast scheint es so, als habe die gerade noch verstreute Redaktionsmannschaft ein unsichtbarer Energiestoß elektrisiert, Auftakt für ein faszinierendes, sich selbst organisierendes Zusammenspiel.“
Weil es so schön ist, noch eine Kostprobe, wie aus dem besabberten Kavalierstuch von Stéphane Mallarmé stibitzt:
„Tatsächlich versucht der SPIEGEL-Journalismus ziemlich viel gleichzeitig zu sein – kritisch und unerbittlich, aber auch nahbar und berührbar, ermutigend und sensibel, dies schon alles deshalb, weil die Schrecken der Welt und der allgemeine Krisentumult die Sehnsucht nach ein wenig Licht und Wärme – Stichwort News Fatigue – verstärken, gerade bei jüngeren Menschen.“
Weil nun aber doch abschließend irgendwas Substanzielles herangezogen werden soll, man aber den naheliegenden Vergleich mit den neuen Medien weiter scheut, wird von Pörksen die „Zeit“ als „das zentrale Konkurrenzmedium“ vorgestellt. Es kann ja tragischer nicht sein, denn hier kommt auch noch Stutenbissigkeit unter den regierungsnahen Medien um die Ecke.
Der Text ufert aus, er mäandert. Und zuletzt liefert Pörksen noch eine unfreiwillig komische Definition ab, warum regierungsnaher Journalismus seriös sein soll:
„Der seriöse Journalismus ist in einen ruinösen, gesellschaftspolitisch weitgehend unverstandenen Kampf um Autonomie verstrickt. Und er muss, um überhaupt zu überleben, in einer oft boulevardesken, sich permanent verändernden Aufmerksamkeitslotterie mitspielen, deren Regeln von ein paar Big-Tech-Giganten nach Belieben variiert werden.“
Die Kritiker des Spiegels liefern nur „sprachlich veredeltes Stammtischgeblöke“, endet Medienwissenschaftler Pörksen sein gescheitertes Greenwashing des Spiegels. Ein Text, der das genaue Gegenteil dessen bewirkt, was er erreichen wollte: Er spielt den Kritikern des „Spiegel“ direkt in die Hände.
Zur Quelle wechseln
Author:
Alexander Wallasch