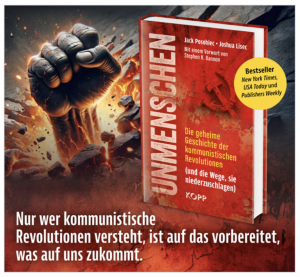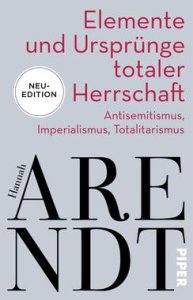Ausgerechnet beim Einkaufen wurde mir schmerzlich bewusst, wie weit sich die selbst ernannte Elite in Deutschland von den einfachen Menschen entfernt hat. Ja, dass es zwei Parallelwelten sind, die da nebeneinander existieren. Eine Verkäuferin in einem Kaufhaus in München hat mich am Freitag erkannt und sich bei mir bitter beschwert über die geplante – und später vorerst gescheiterte – Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin.
„Wie kann die CDU als christliche Partei jemanden unterstützen, der sagt, dass man bis zur Geburt abtreiben kann“, fragte die Frau bitter. Den Rest ihrer empörten Äußerungen gebe ich hier lieber nicht wieder – jeder von Ihnen kann sie sich vorstellen.
An dieses Gespräch musste ich denken, als ich heute– wenige Tage und eine gescheiterte Wahl später – Links auf zwei Geschichten zum Streit um die Bestellung von Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin zugeschickt bekam.
Im einen geht es darum, dass Brosius-Gersdorf prominente Unterstützung bekam. Von 280 Wissenschaftlern und ehemaligen Verfassungsrichtern – darunter befindet sich ausgerechnet die ehemalige Vorsitzende des Ethikrates, Alena Buyx. Die Frau, die mit ihrem blinden Kadavergehorsam in Sachen Corona und ihrem Impf-Totalitarismus für viele Menschen geradezu zu einem Symbol für die Kompromittierung der Wissenschaft geworden ist. Dass nun ausgerechnet sie sich hinter Brosius-Gersdorf stellt, wirkt wie ein Treppenwitz.
Das Schreiben der Unterstützer wirkt so, als stamme es aus der DDR. Es stellt die Realitäten auf den Kopf. Der öffentliche Umgang mit Brosius-Gersdorf sei geeignet, „die Kandidatin, die beteiligten Institutionen und mittelfristig über den Verfall der angemessenen Umgangskultur die gesamte demokratische Ordnung zu beschädigen“, heißt es in dem Statement.
Also nicht die Tatsache, dass die SPD eine Kandidatin mit linksradikalen Ansichten zur Verfassungsrichterin machen wollte, diskreditiert die „demokratische Ordnung“, sondern der Umstand, dass dieses Vorhaben an Teilen der Unionsfraktion gescheitert ist.
Weiter heißt es, Brosius-Gersdorf sei eine „hoch angesehene Staatsrechtlerin“, ihre wissenschaftliche Reputation infrage zu stellen, sei daher unsachlich.
Wie bitte? Zum einen geht es nicht um ihre wissenschaftliche Reputation, sondern um ihre politische. Und zum anderen ist das „infrage stellen“ eine demokratische Tugend. Zumindest in funktionierenden Demokratien. Aber nicht (mehr) so im Gesinnungsstaat Bundesrepublik Deutschland.
Wer die Positionen der Dame ablehne, habe in den meisten Fällen keine Kenntnisse der rechtswissenschaftlichen Diskussion, so der Vorwurf der Unterstützer. Die damit zeigen, wie weit sie sich von dem losgelöst haben, was man früher als den gesunden Menschenverstand bezeichnete. Über dieses Phänomen – dass gerade Akademiker besonders anfällig für Kadavergehorsam und politische Moden und Zeitgeist sind, habe ich erst kürzlich einen eigenen Artikel verfasst (Warum kluge Köpfe sich so leicht manipulieren lassen…und warum einfache Leute oft mehr Durchblick haben).
Und doch wäre es zu billig, jetzt einfach alles auf den – in meinen Augen zweifelsfrei belegten – ideologisch motivierten Versuch abzutun, das Gericht umzubauen. Denn auch die Kritik am Umgang mit Brosius-Gersdorf hat in Teilen ihre Berechtigung, wie man bei nüchterner Betrachtung eingestehen muss. Man kann, ja muss sich fragen, wie es sein kann, dass eine Kandidatin erst im Richterwahlausschuss durchgewunken – und dann kurz vor der Abstimmung öffentlich demontiert wird. Der offene Brief von knapp 300 Rechtswissenschaftlern mag anmaßend formuliert sein, aber zumindest ein Kern der Vorwürfe trifft durchaus zu: Die Union hat sich in dieser Personalie dilettantisch, feige und führungsschwach verhalten.
Dass sie Brosius-Gersdorf zunächst mitnominierte, um dann – offenbar aus Angst vor empörten Mails und Schlagzeilen – in letzter Minute zurückzurudern, ist ein Armutszeugnis. Kein Wunder, dass selbst Peter Müller, früherer Ministerpräsident des Saarlands, CDU-Urgestein und langjähriger Verfassungsrichter, die eigene Partei öffentlich rüffelt: „Das ist ein eklatantes Führungsversagen.“ Und er hat recht. Wenn man einer Kandidatin zustimmt, trägt man Verantwortung. Dann prüft man vorher, ob die Mehrheit steht. Oder man sagt gleich Nein. Aber beides gleichzeitig – Ja im Ausschuss, Nein im Plenum – geht nicht. Das ist nicht konservativ, das ist charakterlos.
Müllers zweite Warnung ist noch grundsätzlicher: Wer am Bundesverfassungsgericht anfängt, Parteipolitik zu treiben, der ist nicht gesprächsfähig. Und genau das ist das Dilemma. Auf beiden Seiten. Die SPD wollte mit Brosius-Gersdorf ein Signal setzen und den linksradikalen Umbau der Bundesrepublik weiter zementieren. Und die Union wollte das Signal abfangen – aber ohne Rückgrat, ohne Linie, ohne Strategie.
So bleibt der Eindruck eines politischen Spiels mit der Justiz – von beiden Seiten. Und das ist brandgefährlich. Denn das Bundesverfassungsgericht lebt nicht nur von den Personen, die dort sitzen, sondern von dem Vertrauen, dass sie dort sind, weil sie unabhängig urteilen – nicht, weil sie für die richtige Partei geschrieben oder demonstriert haben.
Doch genau dieses Vertrauen ist längst erschüttert. Nicht erst seit der Nominierung von Frauke Brosius-Gersdorf. Sondern spätestens seit Angela Merkel ihren langjährigen Parteifreund Stephan Harbarth aus dem Bundestag direkt nach Karlsruhe beförderte – ein nahtloser Übergang von der Regierungsfraktion an die Spitze des höchsten Gerichts. Ein Mann, der vor wegweisenden Entscheidungen im Kanzleramt dinierte und sich auf Kurzstrecken im Regierungsjet chauffieren ließ. Der Verdacht politischer Nähe ist da kein bösartiges Konstrukt, sondern eine schlichte Beobachtung. Und er reicht, um das Fundament der richterlichen Unabhängigkeit zu zerstören.
Vor diesem Hintergrund wirkt der Aufschrei über die gescheiterte Wahl von Brosius-Gersdorf fast tragikomisch. Als wäre nicht längst eine Grenze überschritten worden. Als ginge es tatsächlich noch um Neutralität.
Hinzu kommt: Auch Frauke Brosius-Gersdorf selbst hat wenig dafür getan, das beschädigte Vertrauen zu reparieren. Statt sich als souveräne, ausgleichende Persönlichkeit zu präsentieren, wie es dem Amt einer Verfassungsrichterin entspräche, ließ sie über ihre Anwälte eine Erklärung verbreiten – in der sie der Presse eine gezielte Kampagne unterstellt. Man wolle ihre Wahl verhindern, so ihr Vorwurf. Die Kritik an ihrer Haltung zum Thema Abtreibung entbehre jeder Tatsachengrundlage.
Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Brosius-Gersdorf selbst hatte im Februar im Bundestag erklärt, es gebe gute Gründe, die Menschenwürde erst ab der Geburt gelten zu lassen – eine Position, die sie öffentlich äußerte und die selbstverständlich Kritik provoziert. Dass sie diese Kritik nun als „unsachlich“ und „diffamierend“ brandmarkt, offenbart nicht nur Dünnhäutigkeit, sondern ein gestörtes Verhältnis zur Pressefreiheit. Wer so auf demokratische Debatten reagiert, disqualifiziert sich nicht durch seine Haltung – sondern durch seine Reaktion auf Widerspruch.
Bleibt die Frage: Wird Frauke Brosius-Gersdorf doch noch gewählt? Die SPD will an ihr festhalten. Die Union laviert. Brosius-Gersdorf selbst schweigt. Und der Eindruck verfestigt sich: In dieser Republik ist nicht nur die Justiz politisch geworden. Sondern auch die Politik justiziabel – in einem sehr zweifelhaften Sinn.
Und irgendwo in einem Kaufhaus in München weiß eine Verkäuferin noch, was gesunder Menschenverstand ist. In Berlin – und leider auch in Karlsruhe – scheinen das viel zu viele vergessen zu haben.
Merz taumelt ins Kanzleramt – aber um welchen Preis? Das wahre Drama hinter dem zweiten Wahlgang
Geheim-Urteil gegen die AfD: Der Staat brandmarkt – aber die Begründung dafür verrät er uns nicht
CDU unterschreibt ihr Ende – Koalitionsvertrag macht sie endgültig zu rot-grünem Erfüllungsgehilfen
Bild: Screenshot Youtube
Bitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.
Mehr zum Thema auf reitschuster.de

Menschenwürde per Zufall?
Gilt die Menschenwürde erst ab Geburt, wird ihr Schutz zu einer Frage von Timing, Technik oder Zufall. An vier Beispielen veranschaulicht Professor Rießinger, wie brüchig und willkürlich dieses Prinzip in der Praxis ist.

CDU adé, tut Scheiden weh?
Wenn die Menschenwürde für Ungeborene verhandelbar wird, verliert das Grundgesetz seinen universellen Anspruch – und die Gewaltenteilung ihre Schutzfunktion. Von Vera Lengsfeld.

Neue Verfassungsrichterin: Wie war das nochmal mit der Gewaltenteilung?
Eine Richterin mit politischer Mission, gestützt von Rot-Grün: Die SPD hebelt mit Brosius-Gersdorf das Prinzip der Gewaltenteilung aus – und die Union ringt um Haltung und Glaubwürdigkeit. Von Klaus Kelle.