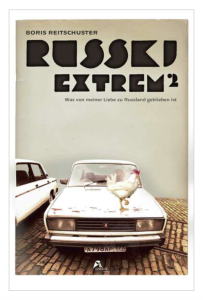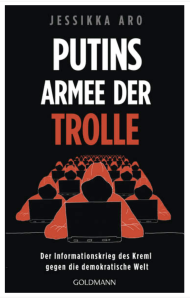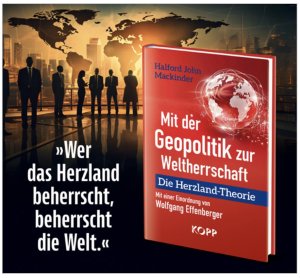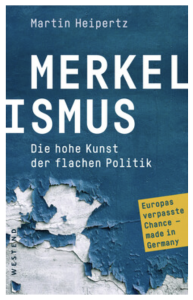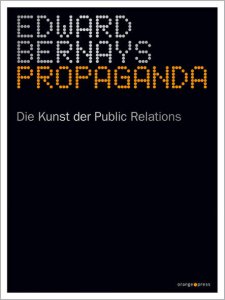Lesen Sie heute Teil 26 von „Putins Demokratur“. Warum ich Buch hier auf meiner Seite veröffentliche, können Sie hier in meiner Einleitung zum ersten Beitrag finden.
Führt zu Seitensprüngen. Dass Russland sich vor dem Hintergrund des Rosenkrieges mit Amerika und der Europäischen Union nach alternativen Partnern umsehen muss, ist aus Putins Sicht nur folgerichtig. Der Kreml-Chef orientiert sich nun in Richtung China.
Gemeinsam mit Peking bastelt Moskau an einem Gegengewicht zu den USA. China gefällt die neue Liaison, weil es von den enormen Rohstoffvorkommen Russlands als Mitgift profitierten möchte. Seine rasant wachsende Wirtschaft hat China inzwischen zum drittgrößten Ölimporteur der Welt gemacht.
Aus Sicht des Kreml treibt der Westen Russland mit seinem ständigen Pochen auf Menschenrechte und Demokratie regelrecht in die Hände des Reichs der Mitte, mit dem es fast vier Jahrzehnte im Dauerclinch lag. Anders als in Washington oder Berlin muss Wladimir Putin in Peking weder von Politikern noch von Journalisten kritische Fragen fürchten. Ebenso wenig müssen die Chinesen sich vor kritischen Tönen aus Russland zu ihrer Tibet-Politik ängstigen. In der Yukos-Affäre war es die chinesische Ölfirma CNPC, die dem Moskauer Staatskonzern Rosneft mit einem Kredit über 6 Milliarden Dollar half, sich die wichtigste Yukos-Tochter unter dubiosen Umständen einzuverleiben.
Die ersten Schritte zu einer Blockbindung sind längst getan. Im Jahr 2001 vereinbarten Peking und Moskau per Vertrag eine strategische Nachbarschaft. Ein großer Teil der russischen Rüstungsexporte geht nach China. Die modernsten russischen Waffen findet man häufiger in der chinesischen Armee als in der russischen.
Kremlkritiker klagen, Russland verliere so des schnellen Rubels wegen seine militärische Überlegenheit. 2005 hielten russische und chinesische Truppen ein gemeinsames Manöver ab – ein Wink in Richtung Washington. In der »Schanghai-Organisation für Kooperation« binden Moskau und Peking die zum Teil diktatorischen früheren Sowjetrepubliken Kasachstan, Kirgisien, Usbekistan und Tadschikistan in Mittelasien an sich. Moskauer Liberale warnen bereits, der lose Zusammenschluss der sechs Staaten könne zum Grundstein einer »Internationale der autoritären Regime« werden. Ein neuer kalter Krieg könnte die Folge sein, fürchtet Dmitri Trenin vom Moskauer Carnegie-Zentrum: »Statt eines Ost-West-Konflikts hätten wir einen Fernost-West-Konflikt: mit dem alten Westen und den früheren Warschauer-Pakt-Staaten plus Georgien und Ukraine auf der einen und Russland, China, den mittelasiatischen Staaten und Weißrussland auf der anderen Seite.«
Doch die Hinwendung zu China birgt für Russland enorme Risiken. Wegen der Macht des asiatischen Riesenreiches wäre Russland lediglich Juniorpartner in dieser geopolitischen Ehe und damit in großer Gefahr, unter den Pantoffel zu geraten und zum Rohstofflager Chinas zu werden. Schon heute sieht sich Russland im Fernen Osten einer zunehmenden »Chinesierung« ausgesetzt.
8 Millionen Einwohnern auf der russischen Seite stehen 100 Millionen Chinesen jenseits der Grenze gegenüber. Zum anderen koppelt Moskau die Regionen mental vom Zentrum ab. Die Russen im Fernen Osten, zumeist Nachkommen von Einwanderern aus Europa, fühlen sich oft als vergessene Stiefkinder des Kreml und fürchten eine Trennung von ihren kulturellen Wurzeln. Nur wenn es ums Kassieren geht, ist Moskau allgegenwärtig, klagen lokale Politiker: Die Regionen müssen heute um ein Vielfaches höhere Abgaben an den Staatshaushalt abführen als zu Jelzins Zeiten. »Wir haben nicht einmal ein Klärwerk in der Stadt. Alle Abwässer gehen in den Pazifik, am Strand kann einem entgegenkommen, was man ins Klo gespült hat«, klagt Wladimir Litwinow, Kleinunternehmer im nahe der chinesischen Grenze gelegenen Wladiwostok: »Wir leben wie in der Dritten Welt, in einem großen Teil der Hochhäuser gibt es nicht einmal Lifte, die Warmwasserversorgung funktioniert seit Jahren nicht mehr.« Dafür sei die Steuerverwaltung umso aktiver: »Die kommen zweimal im Monat zum Abkassieren.« Alles ginge den Bach runter, meint Litwinow, der nach eigenen Angaben ein unpolitischer Mensch war, aber sich der Opposition anschloss, als Moskau japanische Autos mit Rechtslenkrad verbieten wollte – und andere gibt es kaum in Russlands Fernem Osten. »Wenn es so weitergeht, gehört das hier alles in zehn Jahren China«, seufzt er und blickt nachdenklich auf die malerische Bucht.
Frischer Schwung kommt meistens von jenseits der Grenze. Unweit des Pazifiks soll eine moderne, grenzübergreifende Handelszone mit mehreren Luxushotels und Geschäftszentren die Städte Sufinhe (chinesisch) und Pogranitschni (russisch) verbinden. Die Investitionen stammen überwiegend von der chinesischen Seite. Dort ist fast überall die Ausrichtung auf den russischen Markt und die Touristen von der anderen Seite der Grenze zu spüren, es herrscht geschäftiges Leben. Pogranitschni auf der russischen Seite wirkt dagegen beinahe entvölkert und wie eine Sowjetruine. Die Grenzabfertigung dauert auf der chinesischen Seite Minuten, auf der russischen Stunden. China lässt Russen aus der Grenzregion für bis zu 30 Tage ins Land, Chinesen dürfen in Gegenrichtung nur mit Visum passieren, weil Moskau Angst vor illegaler Einwanderung hat.
Auf der chinesischen Seite des Grenzflusses Amur lag gegenüber der russischen Stadt Blagoweschtschensk früher nur ein Dorf. Heute steht dort eine moderne Stadt mit gläsernen Neubauten und einer kleinen Autobahn. Russische Regionalpolitiker beklagen die Unbeweglichkeit und den Kommandoton der Behörden in Moskau und blicken mit Neid auf den Handlungsspielraum, den Peking ihren Kollegen auf der chinesischen Seite der Grenze einräumt.
Viele Russen sprechen bereits von einer »friedlichen Invasion« und erinnern an einen Witz aus Breschnews Zeiten: »Russland hat China den Krieg erklärt. Am ersten Tag ergeben sich 100 Chinesen. Der Kreml jubelt. Am zweiten Tag ergeben sich 1000 Chinesen. In Moskau herrscht Hochstimmung. Am dritten Tag ergeben sich 10 000 Chinesen. Der Generalsekretär sagt, es seien nur noch Tage bis zum Triumph, und trifft Vorbereitungen für eine Siegesfeier. Am nächsten Tag meldet sich der russische Kommandeur aus dem fernen Osten selbst in Moskau: »Mehrere Millionen Chinesen sind dabei, sich zu ergeben, wir müssen den Rückzug antreten.«
Während auf russischer Seite immer noch Angst vor chinesischen Plänen einer militärischen Eroberung der Ostprovinzen herrscht, verschieben sich auf chinesischer Seite die Akzente vom geopolitischen zum geoökonomischen Denken. Schon heute ist das chinesische Bruttosozialprodukt viermal höher als das russische. Liberale fürchten, eine Hinwendung zu China könne zu einer Zerreißprobe für Russland werden und längerfristig zum Auseinanderfallen des Landes führen. Diese Gefahr droht bei einer Beibehaltung des autoritären, zentralistischen Kurses Moskaus jedoch auch ohne Schulterschluss mit China: Eine autoritäre Kommandowirtschaft ist auf Dauer der wirtschaftlich dynamischen chinesischen Konkurrenz nicht gewachsen.
Westorientierte Russen befürchten, dass die Annäherung an China eine Demokratisierung in Russland verhindert. Während ein Westkurs auf Moskau einen Reform- und Modernisierungsdruck ausübe, würde eine Hinwendung zu China längerfristig wohl eher die von asiatischer Tradition geprägten politischen Strukturen Moskaus festigen. China jedenfalls ist wohl mehr an einem autoritären Herrscher im Kreml interessiert als an einer Demokratisierung mit möglicher Hinwendung zum Westen.
Trotz des politisch motivierten Händchenhaltens scheut auch der Kreml offenbar noch vor allzu engen Banden mit dem immer mächtiger werdenden China zurück. Sehr zur Enttäuschung der Pekinger Führung wollte Putin bei seinem China-Besuch im März 2006 keine verbindliche Zusage für den Bau einer Ölpipeline von Sibirien in das Reich der Mitte geben. Den Wünschen der Chinesen zuwider soll die Leitung in den Fernen Osten bis zum Pazifik auf russischem Territorium verlaufen und damit Moskau alle Optionen offenhalten, die Lieferung von Öl nach Japan inklusive. Im Energiepoker um eine Stellung als Weltmacht will der Kreml seine Trümpfe nicht frühzeitig ausspielen.
Bei aller Abkühlung kann sich Russland einen wirklichen Bruch mit dem Westen und hier vor allem mit der EU kaum leisten. Zwar ist Moskau von der harten Haltung der EU in der Kaliningrad-Debatte über Visafreiheit für Transitreisende ebenso enttäuscht wie über die ablehnende Position Brüssels zu den zahlreichen russischen Handelsbarrieren und dem Beitritt zur Welthandelsorganisation (WTO). Auch sieht man den Versuch der Europäer, Russland westliche Werte aufzudrängen, mit Zähneknirschen und will die wirtschaftliche Zusammenarbeit im Vordergrund wissen. Aber auf der anderen Seite wickelt Russland mit den Ländern der EU mehr als die Hälfte seines Außenhandels ab, sie sind wichtige Abnehmer für das Öl und Gas aus Moskau, wofür es zumindest bislang mangels Pipelines noch keine vollwertige Alternative gibt. Die Reisefreiheit in die EU-Staaten hat vor allem in den Großstädten großen Stellenwert für die russische Bevölkerung. Zumindest auf absehbare Zeit ist Russland von Europa ebenso abhängig wie Europa von Russland.
Zündhölzer und Feuerlöscher für Teheran
Auf die Bilder des Grauens reagiert der Präsident mit Härte. Als am 4. Februar 2004 in einem Moskauer Metrozug eine Bombe 39 Menschen in den Tod reißt, wendet sich Wladimir Putin via Fernsehen an die Russen. Die Anschläge seien ein Versuch, ihn unter Druck zu setzen und zu Verhandlungen zu zwingen. Das komme nicht in Frage, betont Putin: »Russland verhandelt nicht mit Terroristen. Es vernichtet sie.«
Zwei Jahre und drei Tage später, am 9. Februar 2006, kündigt Wladimir Putin auf einer Pressekonferenz in Madrid an, er werde die palästinensische Hamas zu Gesprächen nach Moskau einladen. Spaniens Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero zuckt zusammen, denn die Hamas bestrebt zu diesem Zeitpunkt noch eindeutig die Auslöschung Israels; die USA und die EU stufen die Hamas als Terrororganisation ein. »Heute muss man einfach anerkennen, dass die Hamas in den palästinensischen Autonomiegebieten als Ergebnis demokratischer, legitimer Wahlen an die Macht gekommen ist, und man muss die Wahl des Volkes von Palästina respektieren«, sagt Putin. Es müsse eine Lösung am Verhandlungstisch gefunden werden. Hamas-Führer Khaled Mashaal ist erfreut: »Wir begrüßen die mutige Position von Putin.« Russlands Hilfe werde dazu beitragen, »ein gewisses Gleichgewicht« herzustellen und den amerikanischen Einfluss einzuschränken.
Im Westen herrscht Irritation, in Israel Empörung. In Jerusalem spricht Verkehrsminister Meir Schitrit von »einem Dolchstoß in den Rücken Israels« und einem internationalen Skandal: »Was würde Putin denken, wenn Israel tschetschenische Anführer einladen würde?«, so die Frage des Ministers. »Bei Terrorakten der Hamas sind über 550 israelische Bürger ums Leben gekommen, darunter nicht wenige Emigranten aus Russland. Wir verstehen nicht, worin sich die Sprengung eines Omnibusses in Jerusalem von einem Terrorakt in Moskau oder Beslan unterscheidet«, klagt ein hochrangiger Vertreter der israelischen Führung. In Israel leben Hunderttausende russischer Juden; viele von ihnen sind nicht nur israelische, sondern auch nach wie vor russische Staatsbürger.
Kremlanhängern zufolge will Moskau bei den Begegnungen mit den Hamas-Führern die Rolle eines Psychotherapeuten spielen und seine Gesprächspartner auf ein friedliches Zusammenleben mit Israel einstimmen. Mit einer respektvollen Behandlung der Hamas-Leute verfolge Putin zugleich ein innenpolitisches Interesse: Der Kreml müsse berücksichtigen, dass etwa 20 Prozent der russischen Bevölkerung Muslime seien. Im April 2006 sagen Teheran, Katar und Moskau der Hamas Finanzhilfen zu.
Genauso überraschend, wie Putin nach dem 11. September 2001 einen Westkurs verkündete, wechselt er nun im Nahost-Konflikt die Seiten und präsentiert Russland als Schutzmacht der Muslime. Damit verfolgt der Kreml eine Dreifachstrategie: Erstens will er so die Sympathien der knapp 30 Millionen Muslime im eigenen Land einheimsen und auf diese Weise Abspaltungstendenzen vorbeugen. Zweitens soll die Umgarnung islamische Länder davon abhalten, die Aufständischen in Tschetschenien zu unterstützen. Drittens will Moskau wieder eine führende Rolle in der Weltpolitik spielen; mangels militärischer Macht braucht es dafür Partner, die seine Führungsrolle anerkennen. Im Iran statuiert Moskau ein Exempel. Der Kreml bietet sich der Welt als Vermittler im Streit um das Atomprogramm Teherans an. Russland hat Teheran geholfen, einen Atomreaktor zu bauen, nun tritt es an, den Mullahs die Urananreicherung im eigenen Land auszureden. Es gehe weniger um »Urananreicherung« als um »Iranbereicherung«, spottet eine Moskauer Zeitung.
Tatsächlich hat Moskau handfeste, über das Atomgeschäft hinausgehende wirtschaftliche Interessen im Land der Mullahs: In Buscher bauen 2500 russische Arbeiter und Ingenieure am ersten iranischen Atomkraftwerk. Bei Fertigstellung winken milliardenschwere neue Aufträge. Und Lieferverträge für Uran in gewaltigen Mengen. Wichtigster Uranexporteur Russlands ist die Firma TENEX. Einer Meldung der staatsnahen Nachrichtenagentur Interfax aus dem Jahre 2003 zufolge sollte TENEX die Entsorgung des verbrauchten Uranbrennstoffs aus dem Atomkraftwerk Buscher übernehmen. Im Mai 2006 bestreitet eine TENEX-Sprecherin auf Anfrage jegliche Geschäftskontakte der Firma mit dem Iran. Generaldirektor von TENEX ist der mehrfach erwähnte Wladimir Smirnow, gemeinsam mit Wladimir Putin Gründungsmitglied der Datschen-Kooperative am See.
Der Uranhauptlieferant für den Iran ist die staatliche russische Atomfirma TVEL. Ihr Vorstandschef ist ein enger Mitarbeiter des skandalumwitterten Telekom-Ministers und Putin-Vertrauten Leonid Reiman: der frühere Telekominvest-Direktor Alexander Njago aus Sankt Petersburg. Njago stirbt am 2. Mai 2006 im Alter von 58 Jahren. Im April 2006 wird der Leiter von Putins Präsidialamt, Sergej Sobjanin, Vorstandsmitglied von TVEL; am 26. Mai 2006 übernimmt er den Vorsitz des Aufsichtsrats.
Russische Oppositionelle werfen der Führung im Kreml vor, sie rüste mit dem Iran ein Regime atomar auf, dessen Raketen eine Reichweite bis Moskau haben, aber nicht bis Washington. Kremlnahe Politiker dagegen beteuern, Moskau könne nur mit guten Beziehungen sicherstellen, dass der Iran die islamischen Gebiete im Süden Russlands und seine zentralasiatischen Nachbarstaaten nicht destabilisiere und die tschetschenischen Rebellen nicht unterstütze.
Moskaus Fernsehsender melden, Russland erobere sich den Platz in der Welt zurück, den es in den neunziger Jahren verloren habe. »Diesen Platz muss man sich nicht ausdenken, er ist uns gegeben durch unsere Geschichte und die Lage unseres Landes«, kommentiert der 1. Kanal: »In den neuen Konflikten in der Welt müssen wir Vermittler und Schiedsrichter sein. Russland ist für Europa und die USA der einzige Garant für die friedlichen Absichten des Iran mit seinem Atomprogramm.«
Die Rechnung geht inzwischen auf. Dabei war Putins Auftritt auf der großen internatonalen Bühne eher mühselig. Im Jahr 2001 hatte der Kreml-Chef den Altpräsidenten Michail Gorbatschow – in Moskau als »wandelnder Sargnagel der Sowjetunion« geschmäht – in streng geheimer Mission in die USA geschickt. Der »Vater der Perestroika« sollte seinen Freund George Bush senior überreden, dass der ein gutes Wort für Putin bei seinem frisch ins Weiße Haus gewählten Sohn einlegt. Der hatte ihm zuvor demonstrativ die kalte Schulter gezeigt, nachdem er im Wahlkampf seinem Widersacher Al Gore zu große Nähe zu Moskau vorgeworfen hatte.
Fünf Jahre nach Gorbatschows demütiger Kuppelei darf Putins Außenminister Lawrow bei seinem Besuch in Washington im März 2006 tatsächlich ins Allerheiligste der Macht, ganz gegen das Protokoll: Bush empfängt ihn im Oval Office des Weißen Hauses. Die Streicheleinheiten werden jedoch nicht aus später Liebe, sondern aus taktischen Gründen verabreicht: Die Russen spielen eine Schlüsselrolle im Atomstreit mit dem Iran und sollen den Konflikt entschärfen helfen. Für die Aufmerksamkeit der Amerikaner zahlt Moskau jedoch einen hohen Preis. Wegen seiner periodischen Flirts mit den »Schurkenstaaten« wird der Kreml im Westen zunehmend als außenpolitischer Unsicherheitsfaktor gesehen. Tatsächlich wirft Washington Moskau vor, es habe im Irak-Krieg Geheimdienst-Informationen über US-Angriffstaktiken und Aufmarschpläne an die irakische Führung um Saddam Hussein weitergegeben. Der Geheimdienst in Moskau weist die Anschuldigungen als »Hirngespinst« zurück. Die USA seien »erbost über die Festigung der Position Russlands auf dem internationalen Schauplatz« und lenkten die Aufmerksamkeit von inneren Problemen ab, »egal mit welchen Mitteln«, klagt ein kremlnaher Experte.
Unbestritten ist hingegen, dass Moskau im Jahr 2000 als Reaktion auf das amerikanische Raketenabwehrprogramm Waffen an den Iran lieferte. Nach Ansicht der USA verstieß Russland damit gegen eine Übereinkunft aus dem Jahr 1995: Im sogenannten »Tschernomyrdin-Gore-Memorandum« ließ sich der Kreml seinerzeit den Verzicht auf Waffenlieferungen nach Teheran mit Finanzhilfen für die eigene Atomwirtschaft vergelten. Ebenso verkauft Russland Rüstungsgüter an Syrien, das in den Augen Washingtons den Schurkenstaaten nahesteht. Im April 2006 verspricht Russlands Verteidigungsminister Iwanow, Russland werde seine Lieferverträge einhalten und dem Iran 32 Tor-M1-Boden-Luft-Raketen liefern, falls keine »außergewöhnlichen Umstände« einträten. Die Ankündigung erfolgt in dem Moment, als sich die Atomkrise zuspitzt und der Westen versucht, eine Drohkulisse gegen die Mullahs aufzubauen, um sie von ihren Atomplänen abzubringen. Der Auftrag für die Raketen hat einen Umfang von einer Milliarde Dollar. Hersteller ist die Firma Almas-Antej, deren Aufsichtsratsvorsitzender ist Viktor Iwanow, einer der engsten Vertrauten von Präsident Putin und Vizepräsidialamtschef. Die USA und Israel zeigen sich besorgt über die Lieferungen. Russland macht geltend, bei den Tor-M1-Raketen handle es sich um Kurzstreckenwaffen, so dass die Lieferung nicht gegen das Völkerrecht verstoße.
Kremlkritiker behaupten, hinter Moskaus Schmusekurs mit den »Schurkenstaaten« stecke Kalkül. Die russische Führung gebe regelmäßig »bösen Jungs« wie Nordkorea oder Iran Streichhölzer, also Waffen oder Atomtechnik, um dann, wenn es brennt, gegen Entgelt mit dem Feuerlöscher aufzutauchen. Dem Kreml gehe es darum, so der Vorwurf, einen möglichst hohen politischen und wirtschaftlichen Preis für seine Vermittlungsdienste herauszuschlagen. Präsident Putin erklärte, er sei überzeugt, dass Washington »die atomare Karte« gegen Teheran nutze, »um auf dem iranischen Markt eine Konkurrenz aufzubauen« – also westliche Firmen statt russischer ins Geschäft zu bringen. Lange Zeit betrachtete Moskau die Iran-Initiativen der EU als Einmischung in ihr Geschäft. Das schenkte den Iranern Zeit.
Aus westlichen Geheimdienstkreisen heißt es, Teheran wolle Moskau täuschen und sich heimlich russisches Raketen-Know-how besorgen. Schon zuvor hatte der Iran Putin hinters Licht geführt und ihn zu der falschen Äußerung veranlasst, das Land produziere kein waffenfähiges Plutonium. Es gibt aber auch eine andere Version: dass der Kreml ein doppeltes Spiel spiele. Boris Jelzin gestand nach Unterzeichnung des Buscher-Vertrags 1995, dass der Kontrakt »Elemente von beidem« enthalte: »friedliche und militärische Atomtechniken«. Deutlicher kommentierte Jelzins Berater Alexej Jablokow schon im Jahr 1995 die Folgen:
»Dank Russland wird der Iran in einigen Jahren in der Position sein, die Atombombe zu bekommen. Durch die Unterzeichnung dieses Vertrages bewaffnet Russland den Iran.«
Atominstitute, Universitäten und Rüstungsunternehmen arbeiteten mit Genehmigung des Kreml mit den iranischen Behörden zusammen. US-Militärspezialisten nehmen an, dass die Russen den Iranern auch beim Bau unterirdischer Regierungsbunker geholfen haben. Das Atomprogramm des Iran würde ohne die Unterstützung Russlands kollabieren, schreibt Bruno Schirra in seinem Buch Iran – Sprengstoff für Europa. Moskau könne durch die nukleare Zusammenarbeit mit Teheran auf Aufträge in zweistelliger Milliarden-Dollar-Höhe hoffen. Vor diesem Hintergrund ist besonders heikel, dass die russische Atomwirtschaft zu großen Teilen von Männern aus dem Umfeld von Wladimir Putin kontrolliert wird. Auf der einen Seite tritt der Kreml international als Vermittler auf, andererseits hat er ganz handfeste wirtschaftliche Interessen. Die russische Opposition glaubt deshalb nicht daran, dass Moskau im Iran-Konflikt ein ehrlicher Makler sein kann, und warnt den Westen vor Blauäugigkeit. Vergeblich, glaubt Hans Rühle, früherer Ministerialdirektor im deutschen Verteidigungsministerium: Der Westen spiele das Spiel Moskaus mit – die EU-Länder, weil sie »in Unkenntnis der Verstrickungen in die problematischen Teile des iranischen Nuklearprogramms in Russland einen ehrlichen Makler sehen, und die Vereinigten Staaten, weil sie sich nicht dem Verdacht ausgesetzt sehen wollen, die diplomatische Karte nicht voll ausgereizt zu haben«.
Wie auch immer die Iran-Krise ende, für Moskau werde es eine weiche Landung, glaubt die Moskauer Oppositionszeitung Nowaja gaseta: »So zynisch es klingt, für Russland ist jede Entwicklung von Vorteil«, schreibt das Blatt – und liefert eine eigenwillige Erklärung für die ambivalente Haltung des Kreml im Atomstreit: »Wenn die Spannung anhält, bleiben die Ölpreise auf hohem Niveau. Wenn es zu Sanktionen oder einem Krieg kommt, werden sie stark steigen.« »Blicken wir den Tatsachen ins Gesicht. Iran wird die Bombe bekommen«, warnt der bekannte US-Jurist Alan Dershowitz im April 2006. »Das Land hat bereits Raketen getestet, die den gesamten Nahen Osten und einen großen Teil Südeuropas erreichen können. Und es behauptet, über 40 000 Selbstmordattentäter zu verfügen, die bereitstehen, seine Feinde mit Terror – auch Nuklearterror – zu überziehen. Nichts wird Iran abhalten. Sanktionen gegen eine reiche Ölnation sind wertloser Protest. Die Diplomatie ist schon gescheitert, weil Russland und China auf beiden Seiten mitspielen.« Mit Atomwaffen bewaffnet und regiert von religiösen Fanatikern, werde Iran zur gefährlichsten Nation der Welt, warnt Dershowitz.
Den vorherigen, fünfundzwanzigsten Teil – Putins Prügeltrupp – finden Sie hier.
Den ersten Text der Buchveröffentlichung finden Sie hier.
Brandmauer abgebrannt: Merz wagt den Tabubruch, Rot-Grün in Schnappatmung – ein Hoffnungsschimmer!
Herr Merz, ist Ihnen die Brandmauer wichtiger als die Bürger? Sie könnten sofort Leben retten!
Impfverweigerer Bittner: Warum der Soldat für seine Überzeugung in den Knast ging und es nie bereute
Bild: Irina Kvyatkovskaya / Shutterstock
Mehr zu diesem Thema auf reitschuster.de

Die faschistische Gefahr
Die russische Regierung inszeniert sich als antifaschistische Kraft, doch Kritiker sehen Nationalismus, Intoleranz und Gewalt, die Minderheiten unterdrücken und die Demokratie gefährden.

Der kaukasische Teufelskreis
Die düstere Realität des russischen Kaukasus: Spannungen und Gewalt prägen das tägliche Leben in Stawropol und Naltschik. Willkommen in einer Welt am Rande des Abgrunds.

Arme Armee
Ein Wehrpflichtiger, der sich selbst verstümmelt, um dem Militär zu entkommen, offenbart dunkle Geheimnisse der russischen Armee. Hinter der Fassade von Ehre und Patriotismus lauern Gewalt und Misshandlung.

Exportschlager Mafia
Ein Diebstahl führt zu unerwarteten Enthüllungen: Die Geschichte zeigt, wie tief verwurzelt die Verflechtungen zwischen Russlands Behörden und der organisierten Kriminalität sind. Ein Blick hinter die Kulissen.
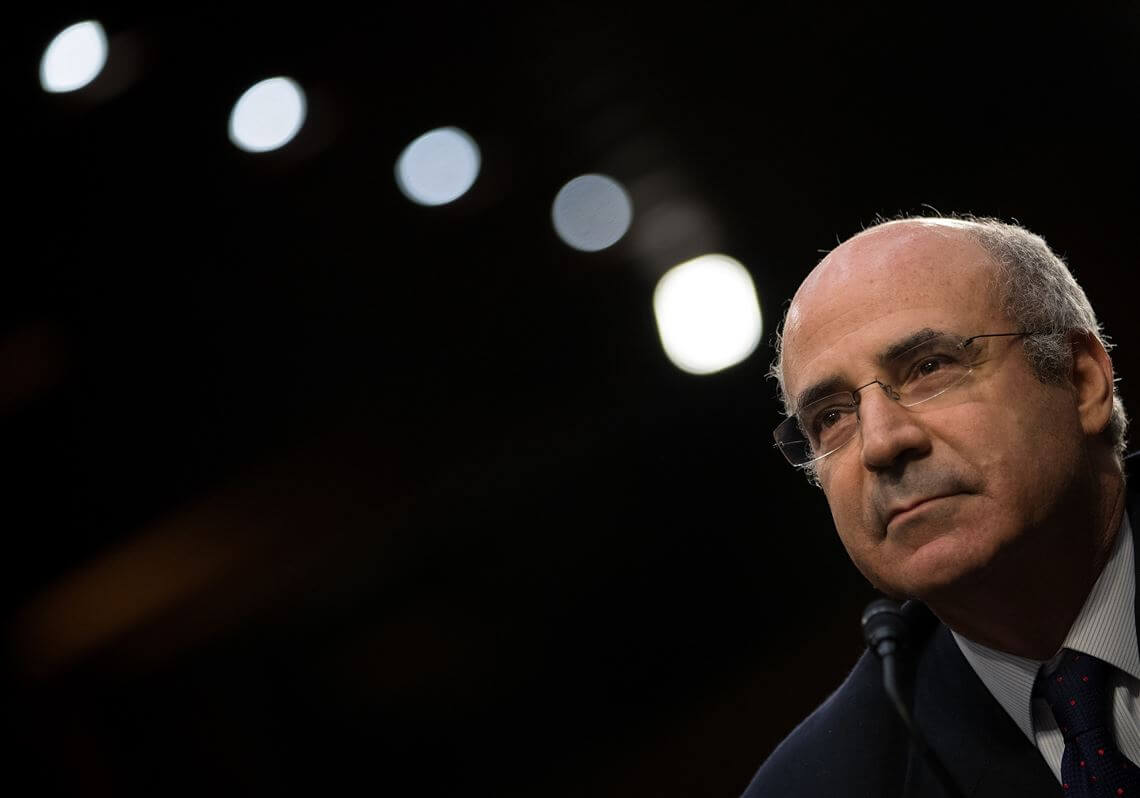
Geschäfte ohne Gewähr
William F. Browder, einst Kreml-treuer Investor, wurde über Nacht zur unerwünschten Person in Russland. Aus dem größten ausländischen Investoren wurde ein Staatsfeind – ein Lehrstück über Loyalität und Willkür.

„Call-Girls“ gegen Yukos
Der Yukos-Skandal war der Höhepunkt im Interessenkonflikt zwischen Apparatschiks und Oligarchen. Chodorkowski verstieß gegen alle Regeln, die Putin für die Superreichen eingeführt hat.

Feinde und Verräter
Der Mord an dem abtrünnigen FSB-Agenten Litwinenko mit hoch radioaktivem Polonium mitten in London erschüttertere die Welt. Der Mörder ist heute Duma-Abgeordneter. Die Spuren führen direkt in den Kreml.

Scheinwelt auf der Mattscheibe
„Die Medien in Russland haben aufgehört, ein Platz für den Meinungsaustausch und öffentliche Debatten zu sein“, klagten Kreml-Kritiker 2005. Moskau war damit Vorläufer für das, was wir inzwischen hier erleben.

Zynismus statt Marxismus
Für einen echten Demokraten wie ihn gebe es „nach dem Tod von Mahatma Gandhi niemanden mehr, mit dem man sprechen kann“, sagte Putin einst. Um zu verstehen, wie er das meint, muss man in die Geschichte schauen.

Farce statt Wahlen
Die Arbeit beim KGB ist geheimnisumwittert. Doch einmal erzählte Putin von einer der KGB-Aktionen – einer „doppelten Kranzniederlegung“. Sie ist geradezu sinnbildlich für Putins heutige Politik in Russland.

Militarisierung der Macht. Teil 2
„Was den Putschisten gegen Gorbatschow 1991 misslungen ist, hat Putin erfolgreich umgesetzt: Die Machtergreifung des KGB“, sagt der KGB-Experte Viktor Tschesnokow.

Putins bombiger Auftakt
Als Jelzin 1999 den unbekannten Putin als seinen Nachfolger aus dem Hut zauberte, waren alle sicher, dass der „Neue“ keinerlei Chance hatte. Doch dann stellte eine Katastrophe alles auf den Kopf.