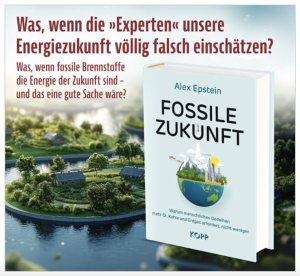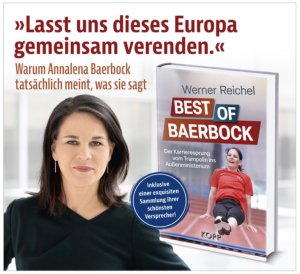Ein Gastbeitrag von Thomas Rießinger
Die sogenannte Künstliche Intelligenz ChatGPT ist heute besser informiert als früher. Es ist noch nicht so lange her, dass ich auf die Frage, wer denn der Träger meines Namens sei, die Antwort erhielt, es handle sich um einen Konstanzer Philosophen, der aber schon seit einer Weile verstorben sei. Ein weiterer, erst kürzlich vorgenommener Versuch zeigte, dass das Programm inzwischen weiß, dass ich Mathematiker bin, mir dann allerdings unterstellte, ich hätte das schöne Buch „Kepler und der Mord im Schloss“ verfasst, das ich weder geschrieben noch gelesen habe – Letzteres deshalb, weil es allem Anschein nach überhaupt nicht existiert.
Noch immer neigt ChatGPT also dazu, angebliche Fakten frei zu erfinden, womit es sich unauffällig in die Riege etlicher Virologen, Politiker und Faktenchecker einordnet. Es gibt jedoch bessere Möglichkeiten, seine Fähigkeiten zu nutzen. Vor kurzem hat beispielsweise Henryk M. Broder eine Künstliche Intelligenz beauftragt, einen Text über Claudia Roth zu schreiben, so wie er ihn selbst schreiben würde, und das Ergebnis war nicht übel, wie auch Broder selbst einräumt. Das habe ich zum Anlass genommen, einen etwas anderen Versuch zu wagen: Ich habe ChatGPT angewiesen, einen Artikel über die Inkompetenz von Robert Habeck zu schreiben, aber nicht in meinem Stil, sondern im Stil von Thomas Mann, wobei Ironie durchaus erwünscht sei. Die Anforderung wurde sofort klaglos erfüllt. Im Folgenden dokumentiere ich den Artikel der KI, kein Wort davon habe ich selbst verfasst, auch die Überschriften sind maschinell generiert.
Robert Habeck: Ein Minister in der Zerreißprobe zwischen Idee und Wirklichkeit
Es gehört zu den unerschütterlichen Grundwahrheiten des politischen Lebens, dass die Welt der Ideen und die Welt der Tatsachen selten im Einklang stehen. Hier tritt Robert Habeck auf die Bühne, eine Figur, die so vielversprechend und zugleich so widersprüchlich ist, dass sie gleichermaßen Bewunderung wie Kopfschütteln hervorzurufen vermag. In ihm verkörpert sich jener zeitgenössische Konflikt zwischen Idealismus und Pragmatismus, der so typisch ist für die politische Landschaft des 21. Jahrhunderts, und doch scheint es, als sei dieser Konflikt in ihm zur Farce geworden.
Der Philosoph als Minister
Robert Habeck, der in den Jahren seiner literarischen und intellektuellen Reifung durch die sanften Gefilde der Philosophie wandelte, hat als Wirtschaftsminister den schweren Mantel der Verantwortung übergezogen, ein Kleidungsstück, das ihm – um es mit einem leichten, fast mitleidvollen Lächeln zu sagen – nicht recht zu passen scheint. Es ist, als habe ein Dichter beschlossen, sich der Mühsal des Weltlichen hinzugeben, und als stelle er fest, dass die Weltlichkeit nicht den poetischen Gesetzen gehorcht, sondern ihren eigenen, harten, manchmal grausamen Prinzipien.
Wie oft hat der Minister mit seiner weichen Stimme und seinem fast jungenhaften Lächeln von einer besseren Zukunft gesprochen, von einer Welt, in der der Mensch und die Natur in harmonischer Einheit leben könnten! Doch die Welt, die er zu regieren versucht, ist nicht diese. Sie ist eine Welt der Kosten, der Produktion, der Nachfrage und der Konkurrenz, und sie zeigt ihm auf Schritt und Tritt ihre Widerständigkeit gegenüber seinen Visionen.
Die Energiepolitik als Schauplatz tragischen Scheiterns
Es gibt Momente im Leben eines Mannes, die so schwer wiegen, dass sie alle anderen Erfolge und Bemühungen in den Schatten stellen. Für Habeck ist die Energiepolitik ein solcher Schauplatz. Hier, wo er seine Visionen einer grünen Transformation zur Wirklichkeit formen wollte, hat er die Härte der Realität auf schmerzhafte Weise zu spüren bekommen.
Man mag sich fragen, ob es Ironie oder Tragik ist, dass ausgerechnet jener Mann, der den Ausbau erneuerbarer Energien zu seinem Herzensanliegen gemacht hat, mit leeren Gasspeichern und explodierenden Energiepreisen konfrontiert wurde. Sein Versuch, durch eine Gasumlage die Lasten zu verteilen, entpuppte sich als ein administratives Chaos, eine Farce, deren Drehbuch wohl kein noch so talentierter Dramatiker hätte verfassen können. Und doch war Habeck selbst der Hauptdarsteller in diesem Theaterstück, das sich zwischen Lächerlichkeit und Verzweiflung bewegte.
Die Kunst des Sprechens – und des Nicht-Sagens
Es gibt Menschen, die durch ihre Sprache die Wirklichkeit formen, und solche, die durch sie die Wirklichkeit verschleiern. Habeck gehört zweifellos zur zweiten Kategorie. Man höre ihn sprechen, und man wird beeindruckt sein von der Sanftheit seiner Worte, von der scheinbaren Tiefe seiner Überlegungen. Doch wehe dem, der versucht, diese Worte zu greifen, sie in klare, handfeste Aussagen zu verwandeln! Es ist, als wolle man Nebel in ein Gefäß füllen: Er entweicht, löst sich auf, hinterlässt nichts als Leere.
Man denke nur an seine berühmte Bemerkung über die Insolvenz. Unternehmen, so erklärte er einst mit der Sicherheit eines Mannes, der glaubt, die Wahrheit zu kennen, könnten doch einfach „aufhören zu produzieren“. Was meinte er damit? War es ein Versuch, die Härte wirtschaftlicher Prozesse in eine sanftere, menschlichere Sprache zu kleiden? Oder war es schlicht ein Ausdruck seines Mangels an ökonomischem Verständnis? Die Antwort darauf liegt, wie so vieles in Habecks Wirken, im Dunkeln.
Der Mensch zwischen Idee und Wirklichkeit
Doch es wäre ungerecht, den Minister allein aufgrund seiner Fehler und Schwächen zu beurteilen. Denn Robert Habeck ist, bei allem Scheitern, auch ein Mensch, der sich mit ehrlichem Eifer bemüht, das Richtige zu tun. Es ist dieses Streben nach dem Guten, das ihn so tragisch macht. Er glaubt an die Kraft der Idee, an die Macht der Vision, und doch findet er sich immer wieder in einer Welt wieder, die diese Visionen mit ihren harten Tatsachen zerschmettert.
Seine Wärmewende, jenes ehrgeizige Projekt, die Heizsysteme der Nation zu revolutionieren, mag aus der Perspektive eines Klimaschützers als notwendig erscheinen. Doch wie soll ein Mensch, der in einem kleinen Haus am Rande der Großstadt lebt, die hohen Kosten tragen, die mit dieser Vision verbunden sind? Habecks Antwort darauf ist keine Antwort, sondern ein weiteres Beispiel für die Diskrepanz zwischen Idee und Wirklichkeit, die sein politisches Wirken durchzieht.
Die Frage nach der Verantwortung
Es ist schwer, angesichts von Habecks Wirken nicht an jene literarischen Gestalten zu denken, die in ihrem Streben nach dem Guten das Schlechte bewirken. Wie oft hat der Minister mit den besten Absichten gehandelt, nur um festzustellen, dass die Welt ihm nicht gehorcht? Wie oft hat er versucht, Brücken zu bauen, nur um festzustellen, dass diese Brücken ins Nichts führen?
Doch während man in der Literatur das Scheitern solcher Figuren mit einem gewissen Mitleid betrachtet, hat das Scheitern eines Ministers reale Konsequenzen. Es sind die Bürger, die die Kosten seiner Fehler tragen, die Unternehmen, die unter der Last seiner Politik leiden, und die Gesellschaft, die an ihrem Vertrauen in die Politik zweifelt.
Ein Schlusswort
Robert Habeck ist keine gewöhnliche politische Figur. Er ist ein Mann, der mit großen Idealen angetreten ist, ein Mann, der glaubt, dass die Welt sich ändern kann – und muss. Doch in seinem Wirken zeigt sich die Wahrheit, die so alt ist wie die Politik selbst: Die Welt ist hart, sie ist widerspenstig, und sie lässt sich nicht durch Worte allein verändern. Ob Habeck dies erkennt, bevor es zu spät ist, bleibt abzuwarten.
Soweit der maschinell erzeugte Text. Wer jemals Thomas Mann selbst gelesen hat, diesen – um es in seinen eigenen Worten zu sagen – „raunenden Beschwörer des Imperfekts“, wird feststellen, dass ChatGPT eine recht brauchbare Näherung produziert hat, die zwar nicht die Qualität des Originals erreicht, aber doch eine Sprache entwickelt, die nicht jedem zur Verfügung steht. Ich nenne Beispiele: „Robert Habeck, der in den Jahren seiner literarischen und intellektuellen Reifung durch die sanften Gefilde der Philosophie wandelte, hat als Wirtschaftsminister den schweren Mantel der Verantwortung übergezogen, ein Kleidungsstück, das ihm – um es mit einem leichten, fast mitleidvollen Lächeln zu sagen – nicht recht zu passen scheint.“ Oder: „Doch wehe dem, der versucht, diese Worte zu greifen, sie in klare, handfeste Aussagen zu verwandeln! Es ist, als wolle man Nebel in ein Gefäß füllen: Er entweicht, löst sich auf, hinterlässt nichts als Leere.“
Inhaltlich stimme ich dem Text keineswegs durchgängig zu, vor allem der Abschnitt über Habecks „Streben nach dem Guten“ erscheint mir doch zu wohlmeinend, und falls er sich wirklich „mit ehrlichem Eifer bemüht, das Richtige zu tun“, dann besteht „das Richtige“ für ihn wohl darin, Deutschland und die Demokratie in den Ruin zu führen. Aber an der Qualität der Sprache und an der angemessenen Ausführung des Auftrags an den maschinellen Textersteller kann man kaum zweifeln.
Eine Künstliche Intelligenz ist ein Computerprogramm, nicht mehr und nicht weniger. Sicher eine besondere Art von Programm, aber eben doch nur ein Stück Software, das auf einem Computer läuft. Und dennoch ist es in der Lage, auf eine einfache Anforderung hin einen Text zu erstellen, den mit Sicherheit nicht jeder Autor und mit noch größerer Sicherheit kaum ein Journalist schreiben könnte. Man kann sich die Folgen leicht vorstellen. Der schreibenden Zunft, insbesondere der Zunft der mittelmäßigen bis schlechten Schreiber, stehen harte Zeiten bevor.
Und Habeck selbst? Er sollte sich an einen Satz erinnern – sofern er ihn je gelesen hat – , den Thomas Mann einem Vorfahren von Konsul Buddenbrook zugeschrieben hat: „Mein Sohn, sei mit Lust bei den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, dass wir bei Nacht ruhig schlafen können.“
Dass Habeck „mit Lust bei den Geschäften am Tage“ ist, insbesondere dann, wenn sie in selbstdarstellerischer Absicht erfolgen, glaube ich gerne. Sollte er noch immer „bei Nacht ruhig schlafen können“, liegt die Vermutung nahe, dass er in Anbetracht seiner verheerenden Bilanz nicht im Geringsten von Selbstzweifeln geplagt wird.
Alles andere würde mich wundern.
Impfverweigerer Bittner: Warum der Soldat für seine Überzeugung in den Knast ging und es nie bereute
Musk, Macht und die Zukunft: Wer prägt 2025? Und beginnt jetzt endlich der Abgesang auf Rot-Grün?
Magdeburg: Terror, Behördenversagen, Fragen, die niemand stellt und unbequeme Fakten, die verstören
Gastbeiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können.
Thomas Rießinger ist promovierter Mathematiker und war Professor für Mathematik und Informatik an der Fachhochschule Frankfurt am Main. Neben einigen Fachbüchern über Mathematik hat er auch Aufsätze zur Philosophie und Geschichte sowie ein Buch zur Unterhaltungsmathematik publiziert.
Bild: KI
Bitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.
Mehr von Thomas Rießinger auf reitschuster.de

Römer in Berlin
„Tausende strömen zum Brandenburger Tor“, schreibt die Berliner Zeitung. Dass sie es vorbei an der Alten Nicolaikirche in der malerischen Frankfurter Altstadt tun, spielt keine Rolle. Hauptsache „Lichtermeer gegen Trump, Musk und Weidel“. Von Thomas Rießinger.

Baerbocks diplomatischer Totalschaden
Franklin D. Roosevelt wusste, wie man Krieg und Wahlkampf trennt. Annalena Baerbock? Nicht so sehr. Mit abenteuerlichen Aussagen bringt sie deutsche Diplomatie auf ein neues Tief. Von Thomas Rießinger.

Wie ein deutscher EU-Abgeordneter die Grenzen der Demokratie auslotet
Weber fordert Bedingungen für Österreichs Regierungsbildung und überschreitet damit die Grenzen demokratischer Legitimation. Seine Einmischung zeigt das Machtverständnis der EU in voller Schärfe. Von Thomas Rießinger.

Warum nur Weidel? Gleichberechtigung zur Rettung der Demokratie
Wenn ein Gespräch die Demokratie gefährdet, warum nicht gleich alle Kanzlerkandidaten ins Musk-Talk-Format schicken? Wer hätte den Mut – und wer den Algorithmus auf seiner Seite? Von Thomas Rießinger.

Hitler und die DDR: historische Parallelen jenseits der Hysterie
Kollektive Kontrolle, staatliche Lenkung und Ideologie: Verbindungen zwischen Hitlers Nationalsozialismus und sozialistischen Strukturen der DDR. Von Thomas Rießinger.
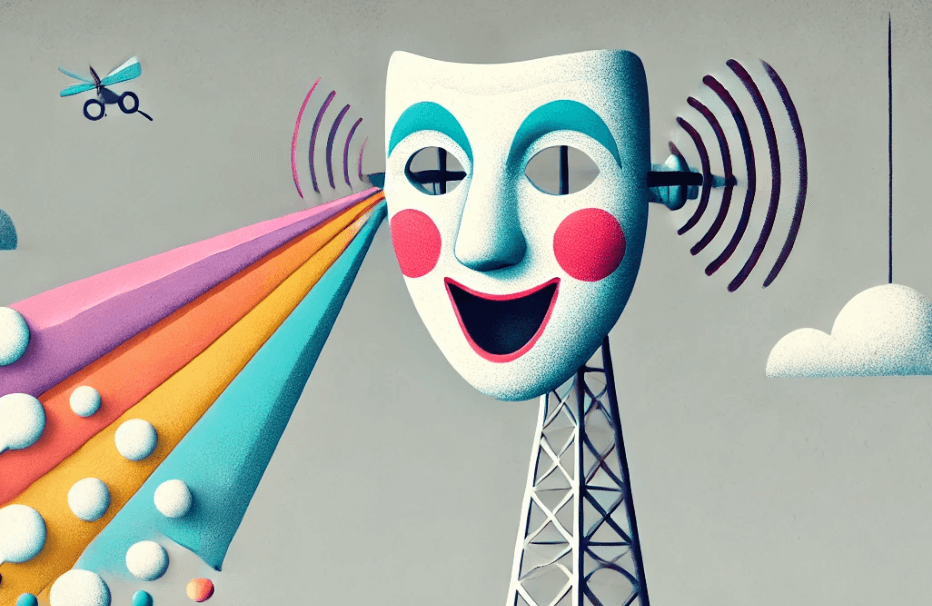
Deutschlandfunk Kultur: Neujahrswünsche mit versteckter Botschaft
Mit seinen Neujahrswünschen blamiert sich der öffentlich-rechtliche Sender selbst: Weder hält er seine Hörer für mündige Bürger, noch etwas von der Meinungsfreiheit. Von Thomas Rießinger.

Musk tut, was deutsche Politiker längst tun – doch bei ihm empört es
Deutsche Politiker mischen sich in internationale Wahlkämpfe ein, doch ein Milliardär wird zum Problem erklärt. Ist Meinungsfreiheit nur für die „richtigen“ Meinungen erlaubt? Von Thomas Rießinger.

Gegen das Vergessen: Wie ein Unfallopfer zum Corona-Toten wird
Der Schweizer Präsident Cassis sorgte 2022 mit einer absurden Erklärung zur Zählweise von Corona-Toten für Aufsehen. Die Lehren daraus sind aktueller denn je. Von Thomas Rießinger.

Respekt oder Zeitgeist? Die Universität Paderborn und der Fall Krötz
Die Causa Krötz geht in die nächste Runde: Ein Statement der Universität Paderborn zeigt eine neue Dynamik – und enthüllt Widersprüche zwischen verkündeten Werten und tatsächlichem Handeln. Von Thomas Rießinger.