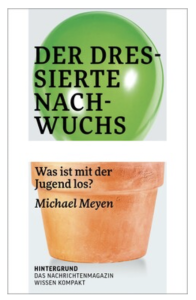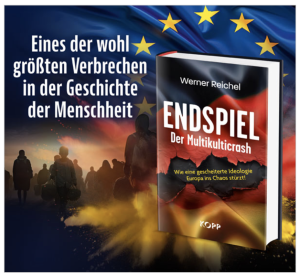Es war ein Sommertag auf dem Bauernhof meines Großonkels. Ich war noch ein Kind, vielleicht sieben oder acht. Mit seinem Enkel ging ich in den Stall – zu einer neuen Gruppe Schweine, die gerade geliefert worden war. Keine rosa Ferkel, wie man sie aus Bilderbüchern kennt, sondern schwarz-weiß gefleckte Tiere, auffallend ruhig, fast schon zu sanft. Wir spielten mit ihnen, liefen durch den Stall, trieben sie ein wenig spielerisch an, lachten, wie Kinder eben lachen, wenn etwas lebt und sich bewegt. Es schien harmlos.
Ein paar Stunden später waren sie tot. Alle.
Kein Unfall. Keine Krankheit. Der Tierarzt sagte nur zwei Worte: zu viel Stress. Diese Schweine, erklärte er, seien hochgezüchtet – empfindlich wie Glas, gezüchtet auf Leistung, nicht auf Leben. Reizarm gehalten, sensibel auf jede Abweichung. Was bei normalen Tieren ein harmloses Spiel gewesen wäre, wurde hier zur tödlichen Überforderung.
Für mich als Kind war das ein Schock. Ich hatte Schuldgefühle. Hatte ich etwas falsch gemacht? Hatte unser Spiel sie getötet? Alle versicherten mir, dass es nicht an uns lag, sondern an der Schweinerasse. Den finanziellen Schaden übernahm die Haftpflichtversicherung. Aber der seelische Eindruck blieb.
Diese Erinnerung kam mir wieder in den Sinn, als ich las, dass Supermärkte ihre Frischetheken abbauen – nicht aus wirtschaftlicher Not, sondern aus Rücksicht auf eine Kundschaft, der schon der Blickkontakt zu viel ist. Und die sich von Wurst und Metzgern „gestresst“ fühlen.
„Focus“ berichtet: Erste Handelsketten kapitulieren vor dem neuen Konsumklima. Kein Personal mehr hinter der Theke, keine Fragen, keine Auswahlgespräche. Nicht etwa, weil niemand mehr Fleisch essen will. Sondern weil die junge Kundschaft zunehmend am Grundprinzip des Einkaufens scheitert: reden, wählen, entscheiden.
Viele meiden die Theke, so der Bericht, „weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen“. Andere scheuen den Blickkontakt mit der Fachkraft. Manche wollen einfach keinen Smalltalk. Und einige trauen sich nicht einmal, im Restaurant selbst zu sprechen – sondern schieben das Gespräch mit dem Kellner den Eltern zu.
Der Metzger von heute ist nicht mehr zu laut oder zu roh – er ist einfach zu real.
Natürlich könnte man sagen, das sei ein neuer Lebensstil. Ein Zeichen wachsenden Umweltbewusstseins. Ein Ausdruck digitaler Bequemlichkeit. Vielleicht sogar alles zusammen. Aber wenn selbst der Wurstkauf zur Zumutung wird – was sagt das über die geistige Resilienz einer Gesellschaft?
In manchen Märkten ersetzt man das bediente Fleisch durch SB-Regale. Nicht, weil es besser ist. Sondern weil es niemanden mehr stört. Weil kein Schwein mehr schreit, wenn es keine Stimme gibt, die noch widerspricht.
Und für alle, denen selbst das zu viel ist, gibt es bereits Konzepte, bei denen die Bestellung per Instagram erfolgen soll – inklusive automatischer Zubereitung und Ausgabe, ganz ohne Kontakt. Eine Art digitales Schnellrestaurant für zwischenmenschlich Unbelastbare. Das ist nicht nur schrullig – das ist Ergebnis jahrelanger Konditionierung auf das Smartphone als Hauptkanal menschlicher Interaktion. Die Jungen tippen, wischen, senden – aber sprechen? Lieber nicht. Wo früher Blickkontakt und Worte genügten, braucht es heute Apps, Emojis und Touchscreens.
Vielleicht ist das moderne Konsumwesen ja tatsächlich wie diese Ferkel von damals: geformt für eine perfekte, reizarme Welt, in der jede Berührung vorsortiert, jede Erfahrung entschärft und jede Entscheidung automatisiert wird.
Nur blöd, wenn dann plötzlich ein echtes Gespräch vor der Theke steht. Oder eine Frage. Oder gar ein Lächeln.
Das alles ist zu viel. Zu unberechenbar. Zu stressig.
Also weg mit dem echten Leben – rein in die Kühltruhe.
Und wer weiß: Vielleicht braucht es bald schon eine Triggerwarnung für die Fleischabteilung. Oder eine psychologische Erstberatung für Kunden mit Kommunikationsangst.
So oder so: Die Wurst wird’s überleben. Ob wir es auch tun, ist ungewiss.
PS: Wer denkt, all das sei Satire, sollte sich die Werbekampagne von Edeka anschauen – siehe hier. Ein Video wie aus einer Dystopie, nur dass niemand mehr merkt, dass es eine ist.
CDU unterschreibt ihr Ende – Koalitionsvertrag macht sie endgültig zu rot-grünem Erfüllungsgehilfen
„UN-fähig“ in New York: Wie Merz Baerbock peinlich nach oben rettet – und was dahinter steckt
Eine Billion neue Schulden – gesamte Union knickt feige ein! Der Bückling des Jahres vor Rot-Grün
Bild: Screenshot Youtube
Bitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.
Mehr zum Thema auf reitschuster.de

Generation Z: lieber Selbstverwirklichung statt Arbeit
Für die ab 1995 Geborenen hat Arbeit nicht mehr die Bedeutung, die sie für ältere Semester hat. Einen guten Lohn und viel Wertschätzung erwarten sie trotzdem dafür. Ein Generationenforscher schlägt Alarm. Von Daniel Weinmann.

Die stille Krise der Generation Z – Freiheit versus Konformität
In einer Welt der kleinen Bubbles hat sich bei der Generation Z Selbstzensur als Schutzmechanismus etabliert. Konformismus ersetzt Rebellion und experimentelle Freiheit. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Von Ekaterina Quehl.

„Es gibt hier ganz viele geile Salate und nur die ekligen sind vegan“
Jedes Land bekommt die Zukunft, die es verdient. Was das für Deutschland bedeuten könnte, offenbart ein kurzes Handyvideo. Dieses mag zwar infantil sein, die Warnung dahinter ist dafür aber umso deutlicher. Von Kai Rebmann.