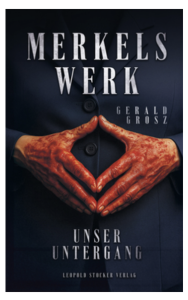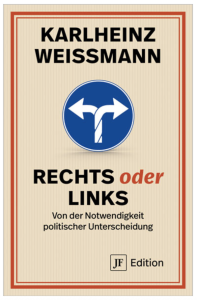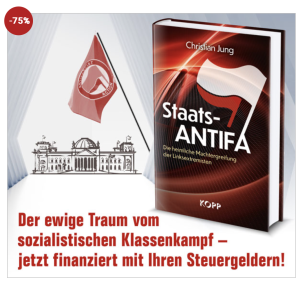Ein Gastbeitrag von Thomas Rießinger
Ich erlaube mir, ein wenig zu mutmaßen.
Der bekannte Politikexperte Hape Kerkeling, den manche für einen begabten Komiker halten, sah sich vor einigen Jahren veranlasst, mit seinem Gatten von Berlin nach Köln zu ziehen. Vor etwa einem Jahr konnte man auch die Gründe für den Umzug vernehmen: Er habe die „homophobe Atmosphäre“ in Berlin nicht mehr ausgehalten. „Mein Mann und ich konnten in Berlin nicht mehr völlig ohne Probleme Arm in Arm über die Straße gehen, was übrigens in Hamburg und Köln überhaupt kein Problem ist.“
Nun könnte man fragen, wer wohl die homophobe Atmosphäre in Berlin verursacht und wer Kerkeling offen daran gehindert hat, „ohne Probleme Arm in Arm über die Straße“ zu gehen, und man könnte dabei den Gedanken verfolgen, dass dieser Umstand etwas mit freudig aufgenommenen Neubürgern aus Kulturkreisen zu tun hat, die Homosexualität in ihrer Umgebung eher ungern sehen. Diesen Schluss scheint Kerkeling nicht gezogen zu haben, denn er plädierte kürzlich für ein Verbot eben der Partei, die die Gegner seiner Homosexualität ausgesprochen kritisch betrachtet.
Der Eugen-Bolz-Preis wurde ihm verliehen, mit dem Personen geehrt werden sollen, „die sich in herausragender Weise für Demokratie und Rechtsstaat einsetzen“. „Ein giftiges Gericht gehört nicht auf die demokratische Speisekarte“, meinte er in seiner Rede und bezog sich allen Ernstes auf das windige Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, in dem die AfD als „gesichert rechtsextrem“ charakterisiert wurde – ein Gutachten, das jeder Beschreibung spottet, aber von einem aufrechten Verteidiger unserer Demokratie darf man nicht verlangen, dass er die Machwerke der willigen Mitstreiter der damaligen Ministerin Nancy Faeser sinnverstehend liest. Dass die Laudatio auf den Geehrten auch noch von Dunja Hayali gehalten wurde, die von Demokratie etwa so viel versteht wie Marcel Fratzscher von Ökonomie, und Kerkeling das Preisgeld an die Amadeu-Antonio-Stiftung gespendet hat, deren demokratische Zuverlässigkeit man schon daran erkennt, dass ihre Gründerin Anetta Kahane „in der DDR Informantin der Staatssicherheit“ war, zeigt recht klar, was von diesem Preisträger zu halten ist.
Aber Ernst beiseite! Wenden wir uns lieber den wahren Komikern unserer Zeit zu, den echten Spaßmachern: unseren Politikern und ihren Vorstellungen, über die man Tränen des Lachens vergießen könnte, wenn die Konsequenzen ihres Handelns nicht so traurig und so verheerend wären. Auch in ihren Kreisen wird ein AfD-Verbot gerne diskutiert, und je erfolgreicher die politische Konkurrenz ist, desto lauter wird die Diskussion: Wen man politisch nicht besiegen kann, den muss man juristisch des Feldes verweisen. Man sollte nicht vergessen: So denken Leute, „die sich in herausragender Weise für Demokratie und Rechtsstaat einsetzen“, der Eugen-Bolz-Preis lässt grüßen. Von der SPD ist man nichts anderes gewöhnt. So haben etwa die rechtspolitischen Sprecher der SPD-Fraktionen im Bundestag und in den Landtagen geäußert: „Ein solches Verbotsverfahren ist kein Mittel gegen einen politischen Mitbewerber, sondern eine Intervention zum Schutz der Demokratie und ein Ergebnis der historischen Erfahrungen und der Grundprinzipien der wehrhaften Demokratie“, und ich gehe davon aus, dass schlichte Gemüter so etwas für bare Münze nehmen. Auch Lars Klingbeil, der lupenreine Demokrat mit Wurzeln in der Antifa, ist offen für ein Verbotsverfahren. Dass die Partei des infantilen Totalitarismus, die man auch als Grüne bezeichnet, und die als Linkspartei bekannte SED, deren Fraktionsvorsitzende Reichinnek im Bundestag gerne „Auf die Barrikaden!“ ruft und damit neue parlamentarische Methoden einführt – dass diese Parteien in die gleiche Kerbe hauen, ist nicht überraschend. Die Volksfront hat sich gefunden.
In den Unionsparteien ist man noch etwas vorsichtiger, wenn auch nicht überall. Friedrich Merz, der Meister der Standhaftigkeit, sah beispielsweise im Mai 2025 die Rufe nach einem Verbotsverfahren „sehr skeptisch“, hielt sich aber eine Hintertür offen. „Er habe sich“, schrieb man bei der Tagesschau, „innerlich immer dagegen gewehrt, aus der Mitte des Bundestages heraus Verbotsverfahren zu betreiben“. Warum das eine geöffnete Hintertür ist, werde ich gleich erläutern. Auch der CDU-Generalsekretär Linnemann ist kein Freund juristischer Maßnahmen bei politischer Hilflosigkeit. „Ich halte da nichts von. Die meisten Wähler wählen die AfD aus Protest. Und Protest kann man nicht verbieten.“
Gerade bei unserem geschätzten Bundeskanzler wissen wir allerdings, wie schnell er seine Meinung ändern oder sogar behaupten kann, er habe sie nie vertreten und sei nur falsch verstanden worden. Tatsächlich gibt es auch in der Union andere Stimmen nicht ohne Gewicht. Hendrik Wüst zum Beispiel, der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, der so gerne Kanzler wäre, zeigte sich schon im Juni offen für ein AfD-Verbotsverfahren, Daniel Günther, sein Kollege aus Schleswig Holstein, fordert es sogar, und der Berliner Kai Wegner „sieht im Gutachten des Verfassungsschutzes zur Einstufung der AfD“ – das ist jenes Gutachten, das sich bei etwas genauerer Lektüre als schludrige Praktikantenarbeit entpuppt – „als gesichert rechtsextremistisch eine mögliche Grundlage für ein Parteiverbotsverfahren“.
Drei Parteigranden immerhin, die ihrem Kanzler und Vorsitzenden widersprechen. Zusammen mit der bekannten Standfestigkeit von Friedrich Merz ist das schon Grund genug, der Frage nach den Möglichkeiten und nach den Folgen etwas genauer nachzugehen.
Möglich ist die Einleitung eines Verfahrens auf jeden Fall, und zwar auf verschiedene Arten. In Artikel 21 des Grundgesetzes heißt es: „Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig.“ Aber wer stellt das fest und wer darf danach fragen? Das findet man in § 43 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. „Der Antrag auf Entscheidung, ob eine Partei verfassungswidrig (Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes) oder von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen ist (Artikel 21 Absatz 3 des Grundgesetzes), kann von dem Bundestag, dem Bundesrat oder von der Bundesregierung gestellt werden. Der Antrag auf Entscheidung über den Ausschluss von staatlicher Finanzierung kann hilfsweise zu einem Antrag auf Entscheidung, ob eine Partei verfassungswidrig ist, gestellt werden.“
Somit wird ein Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit beim Bundesverfassungsgericht gestellt, und stellen dürfen ihn der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung. Werfen wir zunächst einen Blick auf den Bundestag. Die Parteien der neuen Volksfront, SPD, Grüne und SED, verfügen zusammen über 269 Stimmen, die absolute Mehrheit der Stimmen liegt bei 316. Vollzähligkeit der Abgeordneten vorausgesetzt, fehlen ihnen somit 47 Stimmen, um einen Antrag durchzubringen. Da vermutlich kein AfD-Abgeordneter seiner eigenen Abschaffung zustimmen wird, sind sie also auf 47 Stimmen aus dem Lager der Unionsparteien angewiesen. Ob sie die erhalten oder nicht, ist derzeit ungewiss. Selbst der vielseitig begabte Fraktionsvorsitzende Jens Spahn hat noch im September geäußert, ein Verbotsverfahren müsse auf sehr festen Füßen stehen, und die sehe er aktuell noch nicht. Das kann in einer Viertelstunde wieder anders sein, wie man an der Verwendung des Wortes „aktuell“ sieht, aber dennoch ist derzeit ein Versuch im Bundestag riskant für die dortigen Antragsteller – er könnte scheitern, und Scheitern verträgt die Volksfront nicht.
Nun hat ja Merz selbst gesagt, er habe sich „immer dagegen gewehrt, aus der Mitte des Bundestages heraus Verbotsverfahren zu betreiben“. Ja, aus der Mitte des Bundestages heraus vielleicht nicht, aber auch die Bundesregierung selbst kann sich an das Verfassungsgericht wenden. Dazu bedürfte es eines Kabinettsbeschlusses, der gegen den Willen der CDU-Minister nicht durchsetzbar ist, doch ich kann nicht ausschließen, dass man sich irgendwann aus Rücksicht auf die sensible Seele von Lars Klingbeil doch noch dem linken Diktat unterwirft und einen Antrag nach Karlsruhe schickt. Merz selbst könnte sich damit herausreden, dass es sich nicht um ein Verfahren „aus der Mitte des Bundestages“ handle, zudem bräuchte er sich nicht mit unbotmäßigen Abgeordneten herumzuschlagen, die vielleicht noch eine vage Erinnerung an die Reste der parlamentarischen Demokratie hegen. Derzeit dürfte unter den CDU-Mitgliedern im Kabinett noch keine große Freude an solchen Ideen vorherrschen, weshalb bis auf Weiteres kein Vorstoß aus dem Kabinett zu erwarten ist. Wie lange das andauert, weiß niemand außer vielleicht Hape Kerkeling.
Aber man muss das Bundeskabinett gar nicht bemühen, Merz muss sich die Finger nicht beschmutzen; das macht er ohnehin nicht gerne. Denn noch eine dritte Möglichkeit existiert: Auch der Bundesrat kann Karlsruhe bemühen, wenn er denn einen Beschluss zustande bringt. Jedes Bundesland hat dort zwischen drei und sechs Stimmen und sendet entsprechend viele Vertreter. Die Stimmen eines Landes können nur einheitlich abgegeben werden, und wofür oder wogegen gestimmt wird, entscheidet die jeweilige Landesregierung. 69 Stimmen sind vorhanden, die Mehrheit liegt daher bei 35 Stimmen.
Und die sind unter Umständen erhältlich. Fünf Länder werden ausschließlich von den drei Parteien der Volksfront SPD, Grüne und SED regiert, nämlich Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und das Saarland. Im Saarland genügt eine der Parteien, ansonsten braucht es zwei oder drei. Zusammen verfügen sie über 18 Stimmen, und ich zweifle nicht daran, dass sie einem Verbotsantrag begeistert zustimmen und ihn gegebenenfalls auch stellen würden. Aber sie sind ja nicht die einzigen Interessierten. Nicht umsonst hatte ich die Regierungschefs von Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein erwähnt, sie alle haben sich in der einen oder anderen Form für ein Verbotsverfahren ausgesprochen. Warum sollten sie sich dann sträuben, sobald ein Land wie das Saarland das Verfahren in Gang bringen will? Der linke Zeitgeist in Form der entsprechenden Presse würde ihnen das nie verzeihen. Ihre Stimmenzahl liegt bei 14, damit sind schon 32 Stimmen zusammen getragen. 35 brauchen sie.
Hier beginnt der Bereich der Mutmaßungen. Es ist denkbar, dass die Anhänger eines Verbotsverfahrens im Bundesrat bei 32 Stimmen stehen bleiben, dann kann der Bundesrat keines auf den Weg bringen. Aber Brandenburg wird von einer Koalition aus SPD und BSW regiert, und das BSW ist Fleisch vom Fleische der Linken; da wäre es möglich, dass man sich für ein Verbot ausspricht, um die linke Kumpanei aufrecht zu erhalten. Es stimmt: Bisher sprechen sie sich dagegen aus, während der SPD-Regierungschef bereits mit den Hufen scharrt, und man wird abwarten müssen, wer sich durchsetzen kann. Mit den vier Stimmen aus Brandenburg wäre die Mehrheit vorhanden. Denkbar ist auch, dass der Grüne Kretschmann aus Baden-Württemberg doch noch zur Hilfe eilt. Der ist zwar bisher skeptisch und meinte, man solle eher die Menschen zurückgewinnen, aber erstens sieht es derzeit nicht so aus, als würde das gelingen, und zweitens sagte er, man müsse „sehr sehr handfeste Beweise“ vorweisen können – und was handfeste Beweise sind, entscheiden gegebenenfalls die Richter am Bundesverfassungsgericht. Zuständig ist dafür der zweite Senat, dessen Vorsitzende in Kürze die bekannte Ann-Katrin Kaufhold sein wird. Sie hat im letzten November geäußert, man solle doch nicht zu ängstlich sein, um ein AfD-Verbot zu beantragen, nur weil es vielleicht scheitern könne, wobei ein eventuelles Verbot nicht das Ende der Maßnahmen gegen rechts sein dürfe – das lässt schönste Hoffnungen zu über ihren Ermessensspielraum beim Beurteilen der sehr, sehr handfesten Beweise, die sich Kretschmann wünscht. Mit seinem Koalitionspartner CDU müsste er dann allerdings – genau wie in Brandenburg Dietmar Woidke mit dem BSW – eine bestimmte Absprache treffen, auf die ich noch zu sprechen komme.
Somit gibt es drei verschiedene Wege, einen Antrag auf ein Verbotsverfahren nach Karlsruhe zu bringen. Die größte Aussicht auf Erfolg scheint bisher der Weg über den Bundesrat zu haben, sofern man die letzten fehlenden Stimmen noch auftreiben kann, was keineswegs sicher, aber auch nicht unmöglich ist. Doch was geschieht, wenn sich eine der möglichen Stellen zu einem Antrag durchringt? Sollte er erfolgreich sein, verlieren nach § 46 des Bundeswahlgesetzes alle Bundestagsabgeordneten der AfD ihre Mandate, entsprechende Regeln gibt es auch für die Abgeordneten in den Landtagen. Der AfD ist daher zu erhöhter Aufmerksamkeit zu raten. Denn wiederum nach § 46 verlieren die Abgeordneten ihre Mitgliedschaft im Bundestag und die Nachfolger ihre Anwartschaft, sofern sie der Partei in der Zeit zwischen der Antragstellung und der Verkündung der Entscheidung angehört haben. Mit dem Beschluss des Bundestages oder des Bundesrates zur Stellung eines Verbotsantrages ist aber noch kein Antrag gestellt, der muss erst noch formuliert und eingereicht werden. Sobald also ein entsprechender Entschluss im Parlament oder im Bundesrat ergangen ist, wären die AfD-Abgeordneten gut beraten, sofort aus der Partei auszutreten, ihre Mandate aber zu behalten. Sie sind dann zwischen der Antragstellung und der Verkündung der Entscheidung nicht Mitglied der Partei gewesen und können daher ihre Mandate bis zur nächsten Wahl behalten. Natürlich auch darüber hinaus, falls nämlich der Verbotsantrag vor Gericht scheitert – ich darf kurz an die neue Vorsitzende des zuständigen Senats erinnern. Inzwischen sitzt allerdings auch Sigrid Emmenegger im Verfassungsgericht, die der Auffassung ist, man könne einen Verfassungswandel erreichen, indem man das Grundgesetz nicht textlich verändert, sondern Gesetze anders interpretiert als bisher. Da kann man schnell einmal interpretieren, dass ein Parteiaustritt kurz vor der Antragstellung eigentlich das Gleiche ist wie einer kurz danach, weil man ihn ja offenbar aus taktischen Gründen vorgenommen habe. Falls nötig, wird Frauke Brosius-Gersdorf sicher gerne ein wissenschaftlich fundiertes Gutachten beisteuern, und man kann ja auch noch Hape Kerkeling fragen. Der Wortlaut des Gesetzes zählt nicht mehr, wenn es der höheren Sache dient.
Da aber erfahrungsgemäß ohnehin kaum einer auf mich hört, gehe ich davon aus, dass mein Ratschlag nicht befolgt wird und somit im Falle eines erfolgreichen Verbotsantrages alle AfD-Abgeordneten ihr Mandat verlieren. Was geschieht dann? Die Mandate sind weg. Die Listenmandate, die nicht direkt im Wahlkreis gewonnen wurden, werden nicht besetzt, die Direktmandate werden nach einer Weile mit neu gewählten Abgeordneten versehen, die aber nicht mehr die alten sein dürfen. Auf Anhieb verschwinden also alle 151 Mandate der AfD im Bundestag, was ihn auf 479 Sitze reduziert. 42 dieser 151 AfD-Mandate waren Direktmandate, die nach ein paar Wochen wieder besetzt sein werden, aber erst einmal sind sie verschwunden. Nun verfügen aber die Volksfront-Parteien SPD, Grüne und SED noch immer über die 269 Sitze, die sie vor dem angenommenen Parteienverbot auch schon hatten. Man sieht leicht, dass das die Mehrheit der Sitze im gewaltsam verkleinerten Bundestag ist. Selbst wenn man mit weiteren Aktionen wartet, bis die 42 Direktmandate nachbesetzt wurden, und wenn man – was nicht sehr wahrscheinlich ist – davon ausgeht, dass die Union alle 42 Direktmandate für sich gewinnen kann, dann hat die Volksfront immer noch 269 Sitze, die Union kommt auf 250, und zwei Abgeordnete sind ohne Fraktion auf weiter Flur.
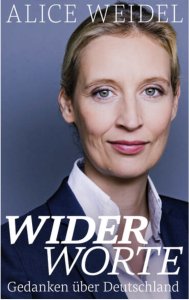
In jedem Fall hat dann die Volksfront die Mehrheit. Soll man ernsthaft glauben, dass sie die nicht nutzt? Zwar ist Merz ein recht gefügiger Kanzler, der in aller Regel das macht, was die SPD will, aber so ganz unverfrorene sozialistische Politik macht sich doch viel leichter, wenn man nicht einmal mehr auf die Scheinkonservativen aus der Union Rücksicht nehmen muss. Das würde auch der sensiblen Seele von Lars Klingbeil gut tun. Ich darf also mutmaßen: Kaum sind die Abgeordneten der AfD verschwunden, wird man mithilfe eines konstruktiven Misstrauensvotums Friedrich Merz aus dem Amt schicken und durch Lars Klingbeil oder irgendeinen anderen aus dem gleichen Lager ersetzen. In diesem Falle hat Deutschland endlich eine Volksfront-Regierung unter Einschluss der SED, die sich heute als Linke bezeichnet. Vorwärts immer, rückwärts nimmer.
Durch Billigung eines AfD-Verbots würden sich also die Union und mit ihr Friedrich Merz und seine Mannen die Macht selbst aus den Händen winden; leichter kann man es der Linken nicht machen. Vermutlich würde sich daran auch lange nichts ändern, denn man kann kaum erwarten, dass bei einer nächsten Wahl die ehemaligen Wähler, die nun nicht mehr wissen, wohin mit ihrer Stimme, zurück zu CDU und CSU oder gar zur SPD kehren werden, denen sie doch aus guten Gründen den Rücken gekehrt hatten. Plausibler ist die Annahme, dass sie erst gar nicht zur Wahl gehen und deshalb die vereinigte Linke die Mehrheit der Restwählerschaft erringt. Falls es überhaupt so weit käme, denn es soll vorkommen, dass Volksfront-Regierungen es mit freien Wahlen nicht so genau nehmen.
Ob Friedrich Merz verstanden hat, dass eine unüberlegte Zustimmung zu einem Verbotsverfahren ihm die Möglichkeit rauben würde, durch die Welt zu fliegen und sich der Illusion seiner eigenen Wichtigkeit hinzugeben, kann ich nicht wissen. Ebenso wenig weiß ich, ob Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, die persönlichen Folgen seines Eintretens für ein Verbot bedacht hat. Denn der ist zwar ein Grün-Roter in der Verkleidung eines Schwarzen, doch sobald alle AfD-Mandate aus dem Düsseldorfer Landtag ersatzlos verschwunden sind, könnte man in grünen Kreisen auf schreckliche Ideen verfallen. Derzeit besetzt die CDU 76 der 195 Sitze im Landtag, die Grünen haben 39, zusammen ist das die Mehrheit. Aber auch wenn nur 12 Mandate der AfD wegfallen, weil sie mehr nicht gewonnen hat, hat das Konsequenzen. Schlagartig gibt es nur noch 183 Sitze, die Mehrheit liegt bei 92. Und die vereinte Linke aus SPD und Grünen – die SED kommt dort nicht vor – darf sich über immerhin 95 Sitze freuen, drei mehr als nötig. Man muss damit rechnen, dass die Grünen schneller den Koalitionspartner und damit auch den Ministerpräsidenten wechseln, als Wüst das Wort „Klimaschutz“ aussprechen kann. Das würde im grünen Lager zu mehr Ministerposten und zu noch mehr Einfluss führen, da die SPD-Fraktion schwächer ist als die der CDU.
Auch Mario Voigt, den über alle Maßen charismatischen Regierungschef Thüringens, kann es treffen. Im Hinblick auf ein Verbotsverfahren hat er sich bisher zwar bedeckt gehalten, doch das ist den Mehrheitsverhältnissen egal. 88 Sitze hat sein Landtag, 44 davon besetzt seine Koalition aus CDU, BSW und SPD. Keine sehr satte Mehrheit, genau genommen gar keine, da auch die Opposition aus AfD und Linkspartei sich an 44 Sitzen erfreut, aber für gelegentliche Notfälle steht die Linkspartei, die SED, gerne bereit. Nach Wegfall der 32 AfD-Sitze sieht das anders aus. Nur noch 56 Abgeordnete bevölkern dann den Landtag, und selbst Politiker können nachrechnen, dass die Mehrheit bei 29 Stimmen liegt. Die bekommen BSW, SED und SPD aber leicht zusammen, sie haben sogar 33 Sitze. Wer oder was sollte sie an einer Koalition hindern? Und schon hat die CDU noch einen Ministerpräsidenten weniger.
Man sieht die weitreichenden Folgen. Mir ist klar, dass es nur mutmaßliche Folgen sind. Zudem sind sie unter Umständen noch an das Einhalten der einen oder anderen Absprache gebunden. Sollte nämlich ein Antrag durch den Bundesrat gestellt werden, dann braucht es nach meiner Mutmaßung entweder die Stimmen aus Brandenburg oder die aus Baden-Württemberg. In Brandenburg regiert die SPD zusammen mit dem BSW, das aber nach einem Ausschluss der AfD aus dem Landtag niemand mehr bräuchte, weil dann die SPD alleine über die absolute Mehrheit der Sitze verfügt. Das würde den BSW-Ministern kaum gefallen, weshalb sich Dietmar Woidke ihre Zustimmung wohl durch ein Abkommen des Inhalts erkaufen müsste, dass er sie dennoch in der Regierung behält. Und in Baden-Württemberg besteht die Regierung aus Grünen und CDU, wobei hier nach dem Verschwinden der AfD aus dem Landtag auch eine für die Grünen bequemere Konstellation aus Grünen und SPD ins Visier rückt. Eine Zusage über den Verzicht auf einen Koalitionswechsel wäre wohl unvermeidbar.
Die Szenarien sind nicht sicher, natürlich nicht. Von der Hand weisen kann man sie auch nicht, und es steht fest, dass der Union im Allgemeinen und Friedrich Merz im Besonderen ein enormer Verlust an Macht und Bedeutung droht, wenn sie sich in einer der beschriebenen Varianten auf die Seite der vermeintlichen Retter „unserer Demokratie“ schlagen und ein AfD-Verbot auf den Weg bringen. Das wäre noch nicht so schlimm, wenn man nicht wüsste, dass Deutschland in diesem Fall noch schneller in den Ruin getrieben wird, weil sich die Volksfront weitgehend ungehindert austoben kann.
„1789 bis 1794 in Frankreich“, schrieb die in linken Kreisen eher unbeliebte Gloria von Thurn und Taxis, „und in den Jahren nach 1917 in Russland konnte die Welt erleben, was geschieht, wenn die linksextremen Schuldzuweiser an die Macht kommen. Sie wollten alles anders machen und machten alles noch viel schlimmer.“
Schlimm genug ist es jetzt schon. Und man kann sich Umstände vorstellen, unter denen die heutigen Verhältnisse wie die guten alten Zeiten erscheinen.
Es muss nicht geschehen. Aber wir sind nicht sehr weit davon entfernt.
Real-Satire pur: Von der Leyen lobt Freiheit – und vor ihren Augen nimmt Polizei Kritiker fest
EXKLUSIV: Staatsanwaltschaft leugnet Tod einer 17-Jährigen – Regierung muss Verfahren einräumen
So wird Demokratie zur Farce: Gericht stoppt AfD-Kandidat, sichert SPD-Sieg und entmündigt Wähler
Gastbeiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Und ich bin der Ansicht, dass gerade Beiträge von streitbaren Autoren für die Diskussion und die Demokratie besonders wertvoll sind. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können.
Thomas Rießinger ist promovierter Mathematiker und war Professor für Mathematik und Informatik an der Fachhochschule Frankfurt am Main. Neben einigen Fachbüchern über Mathematik hat er auch Aufsätze zur Philosophie und Geschichte sowie ein Buch zur Unterhaltungsmathematik publiziert.
Bild: Sybille Reuter / Shutterstock.com
Bitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.
Mehr von Thomas Rießinger auf reitschuster.de

Restle stempelt den Begriff „Zwangsbeitrag“ als Kampfbegriff Ultrarechten
Reflexartig erklärt Georg Restle alle GEZ-Kritiker zu Ultrarechten. Dumm nur: Der Begriff Zwangsbeitrag stammt aus einem Gutachten des Finanzministeriums. Nach seiner Logik wäre das Ministerium also selbst ultrarechts. Von Thomas Rießinger.

Merz setzt auf Stimmung statt Substanz
Nach Klingbeils Beschwörung auf Stimmungswechsel statt Problemlösungen beschwichtigt nun auch Merz mit Optimismusparolen. Doch Gründe dafür liefert er nicht – und hat sie auch nicht. Von Thomas Rießinger.

Realitätsflucht als Regierungsprinzip
Die SPD deutet Unzufriedenheit als bloßes Stimmungsproblem, doch ungelöste Fragen zu Energie, Migration und Sicherheit verschärfen den Abstand zwischen Politik und Bürgern. Eine Analyse von Thomas Rießinger.

ARD verreißt Gerald Grosz‘ neues Buch „Merkels Werk“
Wenn Literaturkritik zur Hasstirade verkommt: ARD-Mann Denis Scheck diffamiert Gerald Grosz’ Buch „Merkels Werk – Unser Untergang“ – ohne Argumente, aber mit moralischem Furor, finanziert aus Zwangsgebühren. Von Thomas Rießinger.

Importierte Kriminalität statt Märchenstunde
Der Malteser-Migrationsbericht 2025 beklagt angebliche Überberichterstattung über ausländische Täter. Doch die Realität zeigt: Kriminalität ist massiv importiert. Von Thomas Rießinger.

Linke relativieren Mord von Charlie Kirk
Wenn ein politischer Mord nicht verurteilt, sondern verhöhnt wird, offenbart das eine moralische Verwahrlosung – und wirft die Frage auf, ob das noch straffrei bleiben darf. Von Thomas Rießinger.

Bahnbrechendes Urteil: Gender-Kündigung gestoppt
Manchmal findet man noch Richter in Deutschland. Eine Bundesbehörde wollte eine Mitarbeiterin wegen fehlendem Gender-Sprech loswerden. Doch das Gericht sah das anders – und kippte Abmahnungen wie Kündigung. Von Thomas Rießinger.

Europas Richter blockieren Abschiebungen
Ein Syrien-Abschiebestopp und neue EU-Vorgaben zeigen: Europäische Gerichte erschweren nationale Souveränität und zwingen Staaten zu immer höheren Leistungen für Migranten. Von Thomas Rießinger.

Aigners „wehrhafte Demokratie“
Präsidentin des Bayerischen Landtages will „gefährliches Reden“ bekämpfen – stellt damit ausgerechnet das Prinzip infrage, das sie zu verteidigen vorgibt: die Meinungsfreiheit. Das Grundgesetz sieht das anders. Von Thomas Rießinger.
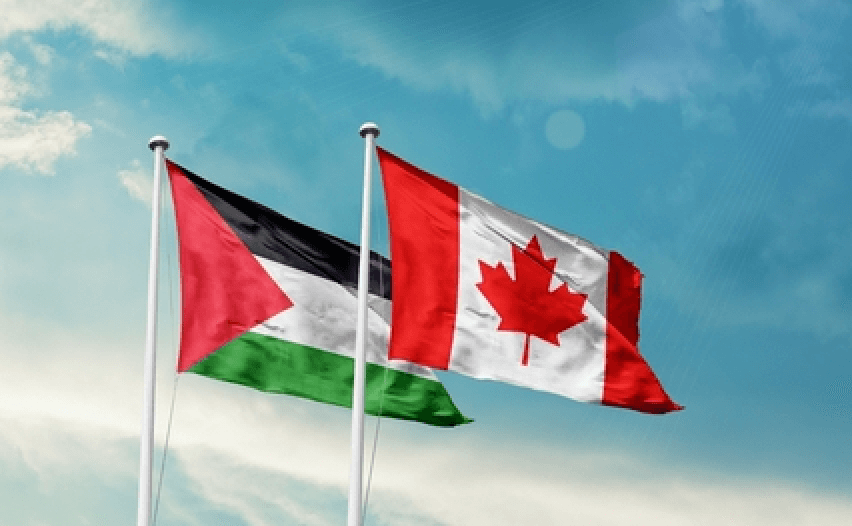
Kanada und Frankreich wollen Palästinenserstaat anerkennen
Hamas an der Macht, keine Wahlen, kein klares Staatsgebiet – trotzdem drängen zwei Staatschefs auf Anerkennung und blenden zentrale Fakten aus. Von Thomas Rießinger.

Solidaritätsadresse für Brosius-Gersdorf: SPD verteidigt „Richterin“
Mit großer Geste prangert die SPD angebliche rechte Bedrohungen an – und entlarvt sich dabei selbst: als Partei, die demokratische Werte rhetorisch beschwört, aber realpolitisch mit Füßen tritt. Von Thomas Rießinger.

Angeblicher Eklat im Bayerischen Landtag: Mikro aus, Argumente egal
Die Landtagspräsidentin entzieht der AfD-Fraktionschefin das Wort – mit Verweis auf Gepflogenheiten, die sonst niemand so genau nimmt. Doch was genau war der Grund? Von Thomas Rießinger.

Als Vernunft noch kein Verdachtsmoment war
Was einst staatsmännischer Realismus war, gilt heute als rechts. Heute hat sich die demokratische Kultur in moralistische Zensur verwandelt. Was sagt das über unser Land? Ein Gedankenexperiment Von Thomas Rießinger.