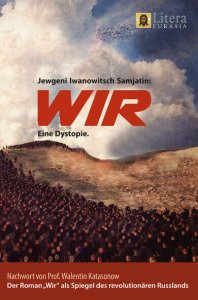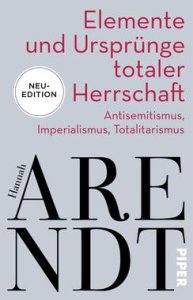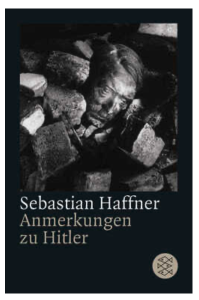Es ist ein Satz, der in Deutschland niemals wieder zu lesen sein dürfte: „Juden haben hier Hausverbot!!!!“ – vier Ausrufezeichen, gedruckt auf einem A4-Zettel, klebten in einem Schaufenster im Flensburger Stadtteil Duburg. Der Ladenbesitzer verteidigt sich auf dem Zettel: Es sei „nichts Persönliches“, er sei „kein Antisemit“, aber „kann euch nur nicht ausstehen“. Parolen wie aus 1938 – nur diesmal mit dem Zusatz: „Ist doch keine Diskriminierung – ist doch nur Meinung!“
Die Empörung ist – ausnahmsweise – groß. Politiker, Medien, selbst die Polizei handeln schnell. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, spricht von „Antisemitismus in Reinform“, Bildungsministerin Prien empört sich, und auf Facebook überschlagen sich die Statements.
Man möchte eigentlich sagen: Alles richtig so. Endlich einmal klare Kante gegen den alten Hass, der sich so gern im neuen Gewand zeigt. Endlich einmal kein Lavieren, keine sprachlichen Wattepads.
Doch leider bleibt einem das Wort „endlich“ im Halse stecken. Denn man muss nur etwas zurückgehen, um zu sehen, wie brutal selektiv dieses moralische Frühwarnsystem arbeitet.
So richtig ich die Empörung in Sachen Flensburg finde – wo ist sie in anderen Fällen? Als AfD-Politiker Alexander Gauland in einem Südtiroler Hotel des Hauses verwiesen wurde oder Alice Weidel dasselbe in Hamburg passierte – nicht wegen Pöbelei, nicht wegen Verhalten, sondern schlicht wegen ihrer Person – da war die Erregung nicht nur klein. Sie war – in weiten Teilen – ein Applaus (siehe hier). Und als ein Gastwirt in Hessen verkündete, dass bei ihm „Rechte“ nicht bedient werden, bekam er dafür Standing Ovations.
Noch deutlicher wird die Schieflage, wenn man sich anschaut, was heute in deutschen Innenstädten längst zum guten Ton gehört: An Kneipen, Cafés, Restaurants, Friseurläden und Theatern kleben Schilder mit Aufdrucken wie „Keine Nazis“, „Kein Zutritt für Rassisten“ – moralisch einwandfrei, möchte man meinen.
Klingt gut. Bis man bedenkt, wie entgrenzt diese Begriffe mittlerweile verwendet werden. Wer die Regierung kritisiert, gilt bei manchen schon als „Nazi“. Wer auf Probleme mit der Migration hinweist, als „Rassist“. Und wer gegen die Ampel wettert, als latent gefährlich. Eine politische Meinung reicht oft – und schon steht man symbolisch neben Himmler.
Die Wirkung dieser Schilder ist real: Sie schaffen ein Klima der Ausgrenzung – legitimiert durch moralische Schlagworte. Kein Gesetz, keine Behörde, keine richterliche Verfügung – und doch wird ausgeschlossen.
Ein Shitstorm? Fehlanzeige. Im Gegenteil: Wer dagegenhält, riskiert die moralische Exkommunikation.
Und genau hier liegt der nächste Schritt dieser Entwicklung: Die Inflation der Begriffe erzeugt nicht nur Ausgrenzung – sondern Angst. Wer heute ein Schild mit „Keine Nazis“ sieht, fragt sich nicht mehr: Bin ich Nazi? Sondern: Bin ich gemeint?
Das ist die perfide Wirkung dieser neuen Moralästhetik: Sie grenzt nicht präzise aus – sie verunsichert diffus. Und sie verwandelt politische Unterschiede in moralische Schuldzuweisungen.
Mit dieser Logik kann jedes Schild an jeder Tür moralisch gerechtfertigt werden. Denn irgendwen „darf“ man ja immer ausschließen – solange man nur die richtigen Worte findet.
Dabei ist der Mechanismus der gleiche: Menschen werden öffentlich ausgeschlossen, weil sie einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden. Weil man sie nicht „ausstehen kann“. Weil man nicht mehr unterscheiden will – oder kann – zwischen Meinung und Mensch.
Der Flensburger Trödler begründet seinen Judenhass mit der Politik Israels – und erklärt, er könne nicht wissen, welche Juden dafür oder dagegen sind. Also raus mit allen. Wer diese Denkweise absurd findet – und das muss man –, der sollte sich ehrlich fragen: Ist es so viel anders, wenn man jemanden aus einem Restaurant wirft, weil er der AfD angehört? Oder gar, weil er „sich nicht klar genug von ihr distanziert“?
Bevor jetzt jemand „Relativierung“ ruft – Klartext: Judenhass ist einzigartig in seiner historischen Schuld und seiner symbolischen Wucht. Wer ihn verharmlost, disqualifiziert sich selbst. Aber wer meint, andere Formen der Ausgrenzung seien harmlos, nur weil sie das richtige Ziel treffen, und man könne deswegen wegsehen oder gar klatschen, disqualifiziert sich ebenfalls.
Es geht nicht darum, den Antisemitismus zu relativieren – sondern darum, die Doppelmoral zu entlarven, mit der Ausgrenzung heute politisch etikettiert wird. Der eine Zettel wird verurteilt, der andere wird beklatscht.
Natürlich: Es ist ein Unterschied, ob man gegen eine Religion beziehungsweise Nationalität hetzt oder gegen eine Partei oder Meinung. Aber im Ergebnis bleibt die Praxis gleich: Stigmatisierung, Ausgrenzung, Herabwürdigung. Und zwar nicht etwa durch „Rechte“, sondern durch jene, die sich als moralische Instanz sehen.
Besonders bitter wird dieser Widerspruch, wenn man bedenkt, wie oft heutiger Antisemitismus von den „falschen“ Gruppen kommt. Islamistische Demonstrationen, „From the river to the sea“-Parolen, brennende Israel-Flaggen – und kaum jemand ruft da: „Nie wieder!“ Weder Prien noch Pescher noch Klein scheinen dann so schnell bei der Hand.
Liegt’s vielleicht daran, dass man sich mit einem Antisemiten im Kaftan schwerer anlegt als mit einem alten weißen Trödler?
Oder daran, dass Antisemitismus aus dem linken oder migrantischen Milieu nicht das Image der „guten Zivilgesellschaft“ beschädigt – sondern zu ihrem eigenen Milieu gehört? Dass man lieber schweigt, weil man sonst die falschen Narrative beschädigen müsste – vom friedlichen Multikulti bis zur moralischen Überlegenheit der Aktivistenszene?
Man könnte es fast übersehen: Der Flensburger Skandal ist, so schockierend er auch ist, kein Einzelfall. Er ist vielmehr eine Lupe – auf eine Gesellschaft, in der Ausgrenzung längst wieder Alltag ist. Nur nennt man sie heute „Haltung“. Oder „Zeichen setzen“. Oder „nicht schweigen gegen rechts“. Und das ist vielleicht die gefährlichste Form der Heuchelei: Wenn man sich als Gegner von Hass inszeniert – aber selbst Hass selektiv duldet.
Vielleicht müssen wir lernen, die neuen Schilder zu lesen. Sie tragen keine Hakenkreuze mehr – sie tragen Regenbogenfarben, „Refugees Welcome“-Banner oder „Kein Platz für Nazis“-Sticker. Und doch ist die Botschaft oft dieselbe: Der Falsche darf hier nicht rein. Es geht um Ausschluss – getarnt als Haltung.
Am Ende bleibt die Frage: Wer schützt uns eigentlich davor, dass die nächsten Zettel nicht nur im Trödelladen kleben – sondern an Arztpraxen, Hotelrezeptionen oder Klassenzimmertüren?
Und schlimmer noch: Wer schützt uns davor, dass keiner mehr schreit – weil es ja die „Richtigen“ trifft?
Wann endlich begreifen wir, dass Ausgrenzer sich immer als gerecht empfanden – und immer glaubten, nur die Richtigen zu meinen?
Real-Satire pur: Von der Leyen lobt Freiheit – und vor ihren Augen nimmt Polizei Kritiker fest
EXKLUSIV: Staatsanwaltschaft leugnet Tod einer 17-Jährigen – Regierung muss Verfahren einräumen
So wird Demokratie zur Farce: Gericht stoppt AfD-Kandidat, sichert SPD-Sieg und entmündigt Wähler
Bild: Screenshot X
Bitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.
Mehr zum Thema auf reitschuster.de

Muslimischer Antisemitismus für Böhmermann böhmisches Dorf
Der ZDF-Komiker bringt seine Zuschauer ausnahmsweise mal zum Lachen – aber unfreiwillig. Wie er sich die Welt entsprechend seiner Ideologie zurechtbiegt, ist phänomenal. Und milieutypisch.

Unfassbare Doppelmoral beim Thema Judenhass
Trotz Gewalt und Aufruf zur Vernichtung von Israel: Politiker und Öffentlich-Rechtliche ignorierten den Aufmarsch einer Hamas-nahen Organisation in Berlin. Corona-Kritikern unterstellt man Juden-Hass, Juden-Hasser schweigt man tot.

Freiheitsentzug als Mittel gegen Judenhass?
Wer die Meinungsfreiheit einschränkt, bevormundet die Mehrheitsgesellschaft. Der traut man offensichtlich nicht zu, sich mehrheitlich von ekelhaften Standpunkten zu distanzieren. So kann der Kampf gegen Antisemitismus nicht funktionieren.