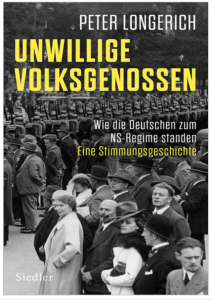Darf man das sagen – und wenn ja, wann? Dass der 8. Mai kein Tag der Befreiung war – zumindest nicht für die Mehrheit der Deutschen? Dass er das Ende eines Verbrecherregimes markierte, aber zugleich der Beginn von Besatzung, Vertreibung, Lagerhaft und neuer Diktatur war?
Solche Sätze galten früher als selbstverständlich – doch inzwischen als Tabubruch. Sie werden zwar (noch) nicht verboten – aber ignoriert oder belächelt. Die wenigen, die sie aussprechen, gelten bestenfalls als gestrig. Dabei sind diese Sätze dringend nötig. Denn wer den 8. Mai feiert, wie es derzeit ausgerechnet die von einem CDU-Bürgermeister regierte Stadt Berlin tut – als arbeitsfreien „Gedenktag der Befreiung“ – der übernimmt ein Narrativ, das nicht aus der ursprünglichen bundesdeutschen Tradition stammt, sondern aus der DDR. Ein Narrativ, das sich später – fast ironisch – sogar bis nach Moskau zurückverirrte.
Ich begegnete ihm dort zum ersten Mal bewusst. Ich war Studienanfänger in der Sowjetunion, neugierig, offen – und politisch wach. Und ich staunte, wie der 9. Mai dort begangen wurde: der „Tag des Sieges“. Nicht der 8. Mai, wie bei uns. In der Sowjetunion endete der Krieg offiziell einen Tag später – mit der nächtlichen Kapitulation, die nach Moskauer Zeit schon nach Mitternacht erfolgte, und deshalb am 9. Mai. In Moskau sprachen viele ganz selbstverständlich auch von der „Befreiung Deutschlands“. Ich war auf vieles vorbereitet – aber nicht darauf, dass gerade dieser Satz so häufig fiel: „Ihr wurdet von uns befreit.“
Damals fand ich das sogar ein bisschen versöhnlich. Und als Richard von Weizsäcker zuvor, 1985 seine berühmte Rede gehalten hatte, in der er den 8. Mai erstmals für die Bundesrepublik zum „Tag der Befreiung“ erklärte, war ich 13 – und beeindruckt. Es schien reif, klug, staatsmännisch.
Erst viel später begann ich zu verstehen, wie tief diese Formel in eine neue Geschichtsschreibung hineinführt. Und wie sehr sie in Wahrheit eine Entlastung ist: Wer befreit wurde, war Opfer. Und wer Opfer war, muss keine Verantwortung mehr tragen. So auch Präsident von Weizsäcker – und insbesondere sein Vater, dessen Verteidiger er bei den Kriegsverbrecherprozessen von Nürnberg war. Und der dort zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war.
Der Historiker Hubertus Knabe hat in einem aktuellen Artikel auf „Achgut“ dieses Deutungsmuster brillant seziert. Er zeigt, wie stark die offizielle Erinnerungspolitik mittlerweile der Logik folgt, die einst die SED in Ostberlin entwickelte. In seiner Analyse heißt es treffend:
„Nicht Deutschland wurde vor 80 Jahren befreit, sondern Europa von den Deutschen.“
Knabe erinnert daran, dass keine der alliierten Mächte 1945 an eine „Befreiung“ Deutschlands dachte – sie wollten den Aggressor vernichten, nicht bekehren. Präsident Truman formulierte es offen:
„Deutschland wird nicht besetzt zum Zwecke seiner Befreiung, sondern als ein besiegter Feindstaat.“
Und doch hat sich heute ein völlig anderes Bild durchgesetzt. Ein Bild, das die Deutschen zu Opfern erklärt – nicht der Alliierten, sondern des eigenen Regimes. Ein Bild, das Schuld individualisiert und auf „die Nazis“ begrenzt, während die „Bevölkerung“ angeblich nur gelitten hat.
Dieses Bedürfnis, sich selbst moralisch zu entlasten, zieht sich durch die gesamte Nachkriegsgeschichte – und mündet heute in einem historischen Revisionismus von links, den ich in einem früheren Artikel beschrieben habe: Dort ging es darum, wie linke Politiker, Journalisten und Aktivisten systematisch versuchen, die moralische Rollenverteilung des Krieges umzuschreiben – bis hin zur Umdeutung von Täter und Opfer.
Dazu passt, dass Berlin den 8. Mai dieses Jahr zum Feiertag erklärt hat – nicht, weil es eine starke historische Kontroverse gäbe, sondern weil es politisch passt. Es ist ein später Triumph des sozialistischen Duktus: Der Begriff der „Befreiung“ wurde durch die Kommunisten in die deutsche Debatte eingeführt – zuerst von der KPD 1945, dann in der DDR institutionalisiert.
Die westliche Skepsis gegenüber diesem Begriff hielt sich bis in die 1980er-Jahre. Kanzler Ludwig Erhard etwa sprach 1965 ausdrücklich nicht von Befreiung, sondern davon, dass der 8. Mai ein Tag sei, „so grau und trostlos wie so viele vor oder auch noch nach ihm“. Die Kapitulation sei kaum mehr gewesen als ein Aufatmen – dass das Morden endlich aufhöre.
Heute dagegen – so Knabe – feiern die Deutschen allein ihre eigene Befreiung, in einem historischen Vakuum. Dass Millionen Deutsche nach Kriegsende vergewaltigt, vertrieben, versklavt oder in sowjetische Lager verschleppt wurden, fällt unter den Tisch. Dass es kaum einen deutschen Widerstand gab, kaum Aufstände, kaum Deserteure, keine Partisanenbewegung – wird verdrängt. Und dass Deutschland nicht befreit wurde, sondern militärisch besiegt – wird umgeschrieben.
Die „Befreiung“ – eine DDR-Legende
Interessant ist dabei: Auch in der Sowjetunion sprach man zwar von der „Befreiung Deutschlands“ – aber stets im Sinne eines militärischen Sieges über den Faschismus. Das heutige Narrativ, Deutschland sei als Ganzes ein Opfer gewesen, wurde nicht dort entwickelt, sondern von der DDR erfunden – als ideologisches Fundament ihres antifaschistischen Selbstbilds. Die SED inszenierte sich als Widerstandsbewegung, obwohl sie systematisch mit alten Nazis weiterarbeitete – sofern sie sich politisch nützlich machten.
Es ist eine bittere Pointe der Geschichte, dass die DDR-Version dieses Narrativs später nicht nur in Westdeutschland übernommen, sondern in Teilen sogar in die Sowjetunion zurückexportiert wurde – wo sie heute in vielen offiziellen Reden mitschwingt, obwohl die Selbststilisierung der Deutschen als Befreite ursprünglich gar nicht zentraler Teil der sowjetischen Siegesrhetorik war.
Die Frage ist nicht, ob man den 8. Mai begehen darf – natürlich darf man. Die Frage ist, was genau man feiert. Die Niederlage? Die Befreiung anderer Völker? Die Chance auf einen Neuanfang?
Oder feiert man – ohne es zuzugeben – die eigene Entlastung?
Ich habe gelernt, vorsichtig zu sein mit Gedenktagen. Sie sagen oft mehr über die Gegenwart als über die Vergangenheit. Und wenn ein demokratisches Berlin heute ein DDR-Narrativ übernimmt, dann nicht, weil es sich um historische Wahrheit handelt – sondern weil es politisch bequem ist.
Denn wer befreit wurde, muss nicht mehr erklären, warum er bis zuletzt mitgemacht hat.
Merz taumelt ins Kanzleramt – aber um welchen Preis? Das wahre Drama hinter dem zweiten Wahlgang
Geheim-Urteil gegen die AfD: Der Staat brandmarkt – aber die Begründung dafür verrät er uns nicht
CDU unterschreibt ihr Ende – Koalitionsvertrag macht sie endgültig zu rot-grünem Erfüllungsgehilfen
Bild: Bundesarchiv, Bild 183-55151-0001 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE via Wikimedia Commons
Bitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.
Mehr zum Thema auf reitschuster.de

Hitler und die DDR: historische Parallelen jenseits der Hysterie
Kollektive Kontrolle, staatliche Lenkung und Ideologie: Verbindungen zwischen Hitlers Nationalsozialismus und sozialistischen Strukturen der DDR. Von Thomas Rießinger.

Änderung des Grundgesetzes: Deutschland schreibt sich um
Ein Sondervermögen mit Verfassungsrang, Klimapolitik als Staatsdoktrin und neue Spielräume für künftige Regierungen. Was bedeutet diese Grundgesetzänderung für Deutschland? Eine Analyse von Thomas Rießinger.

Die DDR-isierung der Bundesrepublik
„Wir haben ein Korn in die Erde gelegt, der Samen wird noch aufgehen“, sagte Margot Honecker nach dem Ende der linken DDR-Diktatur trotzig. So erschreckend es ist: Sie hatte Recht. Meine Analyse zum 3. Oktober.